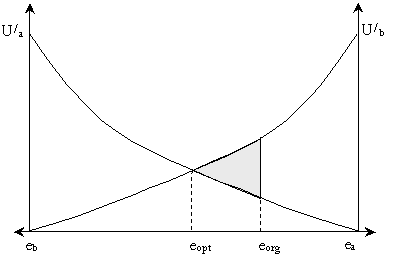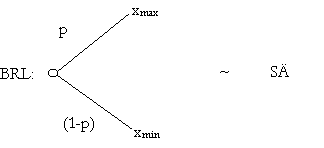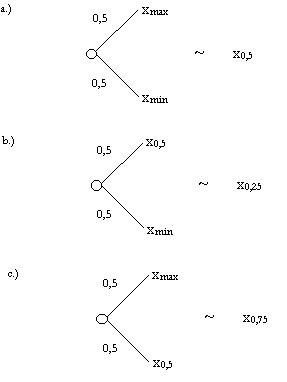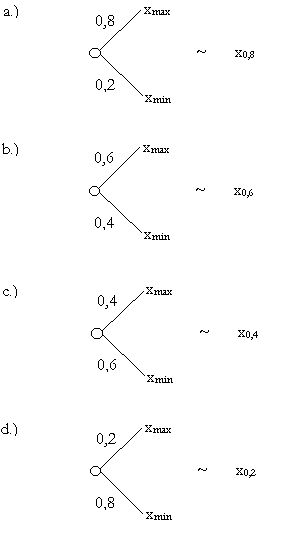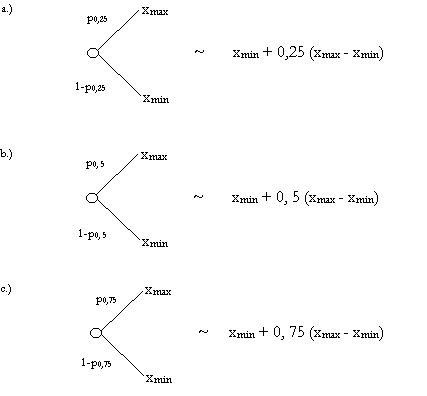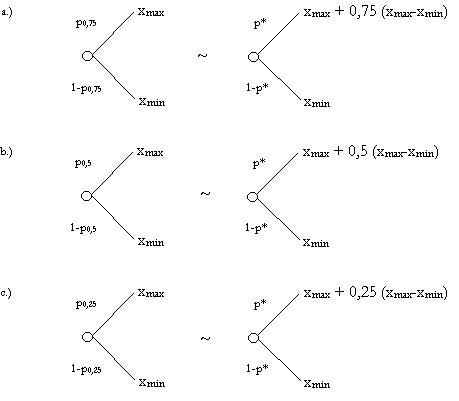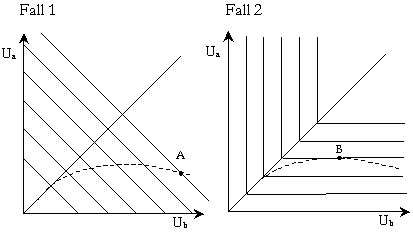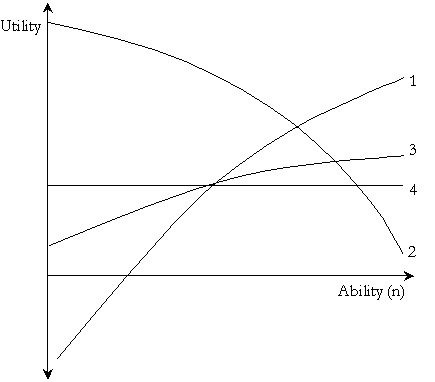Die Wohlfahrtstheorie auf der Grundlage kardinaler Messbarkeit und interpersoneller Vergleichbarkeit von Nutzen – unter besondere Berücksichtigung des klassischen Utilitarismus
(Diplomarbeit, Köln 1999)
Themasteller: Prof. Dr. Ralph Anderegg
Inhalt
1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
2. DER KLASSISCHE UTILITARISMUS
2.2.1 Philosophische Grundlagen
2.2.2 David Hume und der Utilitarismus
2.3.1 Grundlagen der utilitaristischen Ethik
2.3.2 Die subjektive Meßbarkeit von Lust und Schmerz
2.3.3 Bentham und die Einkommensdistribution
2.4.1 Grundlagen des utilitaristischen Liberalismus
2.4.2 Mills qualitativer Utilitarismus
2.4.3 Mills sozialer Liberalismus
2.5 Handlungs- und Regelutilitarismus in der institutionenökonomischen
Betrachtung
2.5.1 Der Handlungsutilitarismus
2.5.3 Vergleich der beiden Varianten des Utilitarismus
2.5.4 Präferenzutilitarismus versus sensualistischer Utilitarismus
2.6 Neoklassik und ältere Wohlfahrtstheorie
2.6.1 Der Einfluß des Utilitarismus auf die Neoklassik
2.6.2 Edgeworth und die Suche nach der Nutzeneinheit
2.6.3 Die ältere Wohlfahrtstheorie
2.6.4 Werturteilsstreit und Kritik der älteren Wohlfahrtstheorie
2.6.5 Die Nutzentheorie von Pareto
2.6.6 Exkurs: Paretos politische Theorie
3.1.1 Marschaks axiomatischer Ansatz
3.1.2 Messung individueller Wertfunktionen
3.1.3 Risikonutzenfunktion und kardinale Nutzenmessung
3.1.4 Ermittlung von Nutzenfunktionen über ungewissen Ereignissen
3.1.5 Methoden zur Bestimmung von Risikonutzenfunktionen
3.2.1 Grundlagen der Theorie des Gesellschaftsvertrages
3.2.3 Gerechtigkeit als Fairness
3.2.4 Die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit
3.2.6 Die entscheidungstheoretische
Begründung für das rawlsianische Differenzprinzip
3.3.1 Der unparteiische Beobachter
3.3.2 Erwartungsnutzenmaximierung im Gleichwahrscheinlichkeitsmodell
für ethische Werturteile
3.3.3 Die axiomatische Formulierung von
Harsanyis Prinzipien
3.3.4 Harsanyis Kritik an John Rawls
3.4 Hayek und der Utilitarismus
1. EINLEITUNG
1.1 Poblemstellung der Arbeit
In dieser Arbeit werden Konzepte untersucht, die Nutzen kardinal meßbar und interpersonell vergleichbar machen. Der Schwerpunkt der Anwendung des kardinalen Nutzenkonzeptes in dieser Arbeit liegt in seiner Bedeutung für die Wohlfahrtstheorie. Neben den allokativen Fragestellungen kann man die Distributionsprobleme als "die andere Hälfte der Ökonomie" betrachten. Gerade für die Analyse im Bereich der Wirtschaftspolitik, bei der es nicht allein um deskriptive Aussagen (was geschieht), sondern vornehmlich um präskriptive Aussagen (was soll geschehen) geht, ist eine enge Verbindung von wertfreier Ökonomik und der normativen Theorie der Wirtschaftsethik unvermeidbar.
Seit der Zeit der Klassik ist der Utilitarismus eine der bedeutendsten
(in der angelsächsischen Welt
vermutlich sogar die dominierende) wirtschaftsethischen Theorien. Durch
ihre Konzentration auf den Nutzen ist sie eine Theorie, die sich mit ökonomischen
Analysen besonders sinnvoll verbinden läßt. Von der ursprünglichen Theorie der
Klassiker, die durch eine starke Durchmischung normativer und positiver Teile
gekennzeichnet ist, führt die Analyse zu den modernen Ansätzen. Sowohl die
entscheidungstheoretische Grundlage und damit die Meßbarkeit im engeren Sinne
als auch die ver-tragstheoretische Untersuchung von Werturteilen führen zu
einer modernen Theorie, welche die ursprüngliche Konzeption der Utilitaristen
in wesentlichen Teilen neu zu begründen vermag.
1.2 Vorgehensweise und Aufbau der Arbeit
Die Arbeit beginnt mit einer dogmenhistorischen Einführung in den klassischen Utilitarismus. Die Vorläufer seit der Antike, insbesondere das Werk Epikurs, werden kurz dargestellt. Dabei können nur Aussagen, die in eindeutiger Verwandschaft zu den behandelten Theorien stehen, exemplarisch herausgestellt werden. Eine qualifizierte Diskussion verschiedener Interpretationen der antiken Autoren kann in dieser Kürze nicht geleistet werden und ist ohne Kenntnisse der Originalsprachen auch kaum zu leisten.
Mit David Hume beginnt die Epoche des klassischen Utilitarismus, wobei offen bleibt, ob er der letzte Vorläufer oder der erste Vertreter dieser Lehre genannt werden sollte. Seine philosophischen Arbeiten können von ihrer historischen Bedeutung kaum hoch genug geschätzt werden und sind von großer erkenntnistheoretischer Tiefe. In dieser Arbeit können jedoch fast ausschließlich die nutzentheoretischen Äußerungen analysiert werden.
Die Werke der beiden Klassiker
des Utilitarismus Jeremy Bentham und John Stuart Mill nehmen den größten Teil der ersten Hälfte
dieser Arbeit ein. Die Verbindung von utilitaristischer Ethik und
Wirtschaftstheorie ist bei ihnen ausgeprägt und in reichhaltiger Literatur
dargelegt. Durch die teilweise unterschiedlichen Standpunkte der beiden Klassiker
lassen sich auch die wesentlichen Probleme der Theorie darstellen. Die bis in
die heutige Zeit fortgesetzte ethische Diskussion, darunter das herausragende
Werk von Henry Sidgwick, wird nur
ansatzweise berührt, weil die theoriegeschichtliche Bedeutung für die Wirtschaftswissenschaft
geringer zu veranschlagen ist. Zahlreiche Überlegungen der modernen Theorien
sind von ihm aber schon vorweggenommen, so die "Versöhnung des Utilitarismus mit Kant".
Die Ausbreitung der Neoklassik beruht nicht zuletzt auf
utilitaristischen Einflüssen. Ihre Grenzwertbetrachtungen wurden als Methode
herangezogen. Mit der Ausarbeitung der Old Welfare Economics, insbesondere im
Werk von Pigou, erreicht die auf enge
Verbindung zwischen Ethik und Wirtschaftstheorie gebaute Betrachtung ihren Höhepunkt.
Mit der Kritik von Vilfredo Pareto beginnt sich das ordinale Nutzenkonzept durchzusetzen. Mit der Kritik an der alten Wohlfahrtsökonomie endet die erste Hälfte dieser Arbeit.
Die modernen Theorien von Rawls und Harsanyi sind eine Synthese aus der älteren Theorie und ihrer Kritik. Sie setzen ihre Werturteile und nutzentheoretischen Annahmen nicht einfach voraus, sondern begründen sie mit Hilfe des Gesellschaftsvertrages. Besonderer Wert wird daher auf die entscheidungtheoretischen Annahmen gelegt. Die Meßverfahren, welche kardinale Meßbarkeit tatsächlich handhabbar machen, werden ausführlich dargestellt. Die Frage der Meßbarkeit ist von zentraler Bedeutung für die Neubegründung utilitaristischer Ansätze in der Wohlfahrtsökonomie. Die dogmenhistorische Darstellung tritt im zweiten Teil zugunsten eines systematischen Aufbaus der Elemente der Theorien von Rawls und Harsanyi zurück.
1.3 Stand der Forschung
Zu den Theorien der Klassiker gibt es verständlicherweise eine unübersichtliche
Vielzahl von Literatur. Durch die rege Diskussion um den Utilitarismus als
Moraltheorie im angelsächsischen Raum ist dort kaum ein Aspekt dieser Theorien
nicht ausführlich behandelt.
Im deutschsprachigen Raum wird weitaus weniger Kenntnis von den behandelten Theorien genommen. Als philosophische Klassiker werden Hume und Mill in den einschlägigen Werken behandelt, Benthams Theorien werden hingegen selten ausführlich dargestellt. In den herkömmlichen ökonomische Lehrbüchern werden die utilitaristischen Beiträge zumeist nur beiläufig und recht oberflächlich abgehandelt. Gesamtbetrachtungen aus ökonomischer Sicht sind hingegen selten; zu erwähnen ist die Darstellung von Bettina Düppen, die den Schwerpunkt auf den Vergleich mit naturrechtlichen Positionen legt. Das Buch von Frank Schernikau kommt dem Thema dieser Arbeit am nächsten, weil es den Schwerpunkt auf die Fragen der kardinalen Meßbarkeit und interpersonellen Vergleichbarkeit von Nutzen legt. Die Darstellung bleibt jedoch dogmenhistorisch, und auf eine eingehende analytische Darlegung der Nutzenmeßung wird leider auch von ihm verzichtet.
Das Werk von Rawls ist inzwischen in der ökonomischen Theorie rezipiert
worden und hat Eingang in die einschlägigen Lehrbücher und Lehrveranstaltungen
gefunden. Das Werk Harsanyis ist weitaus weniger bekannt und wird oft nur als
Kritik an Rawls dargestellt. Eine zusammenhängende Veröffentlichung von den
gesellschaftsvertraglichen Theorien Harsanyis existiert nicht. Sie muß leider
aus einzelnen Artikeln in englischsprachigen Fachzeitungen zusammengetragen
werden, was ihre geringe Wirkung, insbesondere im deutschsprachigen Raum, zu
erklären vermag.
2. DER KLASSISCHE UTILITARISMUS
Die Behandlung des Utilitarismus ist hier im wesentlichen auf seine bekanntesten Vertreter Jeremy Bentham und John Stuart Mill sowie auf die erkenntnistheoretischen Vorarbeiten von David Hume beschränkt. Diese sind nicht nur überragend von ihrer theoriegeschichtlichen Bedeutung, sondern haben bereits die wesentlichen Fragestellungen einer utilitaristischen Ethik herausgearbeitet. Lediglich die Abgrenzung von Handlungs- und Regelutilitarismus ist als moderne Auseinandersetzung in dieses Kapitel eingearbeitet, weil sie sich auch auf die philosophischen Grundlagen der Klassiker bezieht.
2.1 Vorläufer
Die möglicherweise früheste
philosophisch dargelegte Nützlichkeitslehre stammt von dem altchinesischen
Denker Mo Tse ( ca. 500 - 300 v. u. Z.), der „Reichtum für das Land und Vermehrung der Bevölkerung“[1]
zum Maßstab
einer guten Herrschaft macht. Die Entwicklung der westlichen Ökonomie
beeinflußte er vermutlich nicht.
2.1.1 Epikur von Samos
Bereits in der Antike (Epikur
lebte 341 - 271 v. u. Z.) sind einige der Fragestellungen und Lösungsansätze,
die in dieser Arbeit behandelt werden, im Grundsatz aufgetaucht.[2]
Mit dem Eudaimonismus[3]
entstand eine Lehre, welche das Erlangen von Glückseligkeit, auch durch
sinnliche Freuden, zum Ziel menschlichen Strebens erhob: “Ich aber rufe zu fortdauernden Lustempfindungen auf und nicht zu sinnlosen
und nichtssagenden Tugenden, ...“. [4] Bentham
und Mill beziehen sich in ihren Schriften mehrfach auf Epikur und haben vermutlich
viele Anregungen durch ihn bekommen.
Auch zur Qualität von Lustempfindungen hat Epikur sich geäußert: „Es ist nicht möglich, lustvoll zu leben, ohne einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben, (ebensowenig, einsichtsvoll, vollkommen und gerecht zu leben), ohne lustvoll zu leben.“[5] Die Stärke der Lustempfindung von einfachen Genüssen wird von aufwendigen Genüssen nur geringfügig übertroffen, eine Überlegung, die sich sowohl als Vorläufer der Idee des abnehmenden Grenznutzens als auch von Adam Smith´ Nutzenillusion von Luxus interpretieren läßt: “Ich quelle über in meinem Körperchen vor Lust, wenn ich Wasser und Brot zu mir nehme, und ich spucke auf jene Lustempfindungen, die durch aufwendige Mittel hervorgerufen sind, nicht um ihrer selbst willen, sondern wegen der unmittelbar nachfolgenden Beschwerden.“ [6] Auch die Reinheit einer Lust (Purity) im Sinne Benthams als Merkmal ihrer Bewertung wird hier zum Ausdruck gebracht.
Auch Epikurs Auffassungen zur Rechtslehre erscheinen erstaunlich modern. Sowohl ein ökonomisches Kalkül als auch die Idee eines Gesellschaftsvertrages sind in seinen Aussprüchen teilweise zu finden: „Das der (menschlichen) Anlage entsprechende Recht ist ein Abkommen mit Rücksicht auf den Nutzen, einander nicht zu schädigen und sich nicht schädigen zu lassen.“[7] Die gegenseitige Schädigung zu verhindern ist das wichtigste Ziel des Rechts. Wo kein anderer verletzt wird, liegt auch kein Unrecht vor. Diese Überlegung wird von John Stuart Mill in seinem Rechtsliberalismus deutlich ausgebaut.
Epikur und die Epikureer sind in der ganzen Antike und bis in die heutige Zeit als Sinnbild eines hedonistischen, auf kurzfristige, sinnliche Lustbefriedigung ausgerichteten Lebenswandels, ja sogar als lasterhafte amoralische Lüstlinge bezeichnet worden. Dieses Zerrbild ist überwiegend von den Gegnern Epikurs, insbesondere von den Stoikern verbreitet worden. Schon aus den wenigen Zitaten wird deutlich, daß Epikur einfache Genüsse vorzieht, ja er propagiert auch das empfindungslose Ertragen von Schmerzen. Es ist bei ihm jedoch nicht wie im Stoizismus Selbstzweck, sondern die Nichtempfindung vermindert den Schmerz.
2.1.2 Weitere Einflüsse
Einige Theorien, die nicht direkte Vorläufer sind, aber Verwandschaftsbeziehung zum Utilitarismus haben, sind für dessen Entwicklung und Diskussion von so großer Bedeutung, daß sie hier kurz erwähnt werden müssen.
In den Werken Platos finden sich Ideen zur Konstruktion eines Idealstaates, der die Bedürfnisse seiner Bürger optimal befriedigt. Die Bedürfnisse sollen aber durch Einteilung in Gesellschaftsklassen und entsprechende Erziehung (darunter Auferlegung von Schmerzen, Anstrengungen und Entbehrungen) gelenkt werden. Die Bedürfnisbefriedigung im platonischen Idealstaat bedeutet also etwas dem Utilitarismus entgegengesetztes: „Der Reichtum verdirbt die Seele des Menschen durch Genußsucht, (...) .[8] Aber nicht nur das hedonistische Prinzip, auch der Individualismus und alle Prinzipien, die man heute als liberal bezeichnen würde, finden in Plato einen erbitterten Feind.[9]
Von den Denkern der griechischen Antike gilt Aristoteles als derjenige, welcher den größten Einfluß auf das abendländische Denken genommen hat. Seine Theorien bestimmten weitgehend das wissenschaftliche Denken des Mittelalters.
Er stand anders als Plato dem Handel und der persönlichen Freiheit nicht ablehnend gegenüber. Die Gemeinschaft hat vielmehr sogar Interesse an der freien Entfaltung des Einzelnen. Aristoteles beschreibt drei verschiedene Arten, nach denen Menschen Glück erlangen können: erstens durch Lust, zweitens durch Ehre und drittens durch geistige Tätigkeit. In der geistigen und politischen Tätigkeit kann der Mensch ein hohes Maß an Glück finden. Es handelt sich also um ein qualitatives Nutzenkonzept. Die körperliche Lust ist dabei der geistigen untergeordnet, die Herrschaft des Verstandes über die Begierden das Ziel. Der Staat ist auf das Ziel dieser Art der Glücksmaximierung verpflichtet, d. h., er muß ermöglichen, daß die wirtschaftlichen Mittel für ein wohlanständiges Leben produziert werden. Gewinnstreben, welches darüber hinausgeht, ist dagegen von Übel.
2.2 David Hume
2.2.1 Philosophische Grundlagen
Humes erkenntnistheoretischen Grundsätze sind in seinem Hauptwerk „A Treatise on Human Nature“ dargelegt. Er knüpft an den Empirismus von John Locke an. Er nimmt jedoch eine Unterscheidung einfacher Vorstellungen vor. Primäre Eindrücke (Impressions) entstehen durch unmittelbare, gegenwärtige Wahrnehmungen, die wie bei Locke sowohl äußerer als auch innerer Art sein können. Die durch Erinnerung oder Phantasie entstandenen Nachbilder nennt er Ideen (Ideas). Komplexe Ideen entstehen aus einer Verknüpfung der einfachen Elemente durch die Gesetze der Ideenassoziation:
1.) Durch Ähnlichkeit und Verschiedenheit. Die Gesetze der Mathematik bestehen nur aus Verknüpfung von Vorstellungen und sind aus dem Verstand allgemeingültig zu beweisen.
2.) Durch räumliche und zeitliche Nachbarschaft.
3.) Durch das Gesetz der kausalen Verbindung von Ursache und Wirkung.[10]
Dabei sind fehlerhafte Zuordnungen nicht auszuschließen, und Hume wendet sich insbesondere gegen traditionelle religiöse Auffassungen, die auf “Trugbildern des menschlichen Stammes“ [11] beruhen. Er trennt Glauben vom Wissen und wendet sich letztendlich gegen den rationalen Gottesbegriff des Deismus und gegen die Vorstellung einer natürlichen Religion. Mit naturrechtlichen Auffassungen setzt er sich lange auseinander und gelangt schließlich zu einer evolutionären Begründung des Rechts. Letzter Grund für jede Regel ist allein „the convenience and necessity of mankind“.[12]
2.2.2 David Hume und der Utilitarismus
Die Frage, ob man die Theorien Humes überhaupt als utilitaristisch bezeichnen soll, ist überaus umstritten.[13] Einerseits umreißt er ein soziales Nutzenprinzip, anderseits verhalten sich Menschen moralisch, weil sie ein direktes moralisches Gefühl haben. Seine Überlegungen zur Sozialethik sind darauf ausgerichtet, den größten Nutzen für die Gesellschaft zu erreichen: “Es scheint ein so selbstverständlicher Gedanke, das Lob, das wir den sozialen Tugenden spenden, auf ihre Nützlichkeit zurückzuführen, daß man erwarten sollte, bei ethischen Schriftstellern dies Prinzip als die Hauptgrundlage ihres Denkens und Forschens wiederzufinden”.[14] Die Bedeutung von Lust und Schmerz, die Hume zu den direkten Affekten zählt, ist stark, weil er alle anderen Affekte auf sie zurückführt: “Man sieht leicht, daß die Affekte, sowohl die indirekten als auch die direkten, auf Lust und Unlust beruhen, so daß man, um eine Gemütsbewegung zu erzeugen, nur ein Gut oder Übel ihm vorzuführen braucht. Fallen Lust und Unlust fort, so schwinden sogleich auch Liebe und Haß, Stolz und Kleinmut, Begehren und Abscheu, sowie die meisten anderen in der Selbstwahrnehmung gegebenen, also mittelbaren Eindrücke.” [15] Der Stellenwert des Lustprinzips ist bei Hume gleichwohl ein anderer als im Utilitarismus Benthamscher Prägung, denn sie sind zwar Ursache der Affekte. Das menschliche Handeln wird von ihnen indirekt bestimmt, da sie durch die Gesetze der Ideenassoziation verarbeitet werden. Insbesondere die indirekten Affekte Stolz und Niedergedrücktheit bestimmen das menschliche Handeln.
Das Prinzip der Sympathy, d.h. der Fähigkeit, sich in
andere Individuen hineinzuversetzen und mit ihnen mitzufühlen, ist ein Hauptantrieb
des Menschen. Allerdings ist der Gemeinsinn, der daraus wächst, nicht stark
genug, um die egoistischen Triebe der Individuen in Bahnen zu lenken, die sie
dem Gemeinwohl dienen lassen. Es bedarf zusätzlich der Institutionalisierung
von Gerechtigkeitsvorstellung durch den Staat. Die Respektierung von Eigentumsrechten
und die Freiheit von Handel und Gewerbe macht das individuelle Streben der
Gesellschaft nutzbar, ganz im Sinne von Adam
Smith Theorem der “unsichtbaren Hand“.
Der Einfluß von Hume auf den Utilitarismus ist ebenso wie der auf die
Entwicklung der Nationalökonomie eindeutig. Sowohl der klassische Utilitarismus
als auch die Ideen Adam Smith´ oder die Erkenntnistheorie von Immanuel Kant
wurden maßgeblich von Humes Vorarbeiten beeinflußt.
2.3 Jeremy Bentham
2.3.1 Grundlagen der utilitaristischen Ethik
Bentham war der erste
neuzeitliche Denker, welcher das Nutzenprinzip nicht nur zur Erklärung
beobachteten Verhaltens heranzog, sondern es zu einem ethischen Postulat
ausbaute. „Nature has placed mankind under the governance
of two sovereign masters , pain and pleasure. It is for them to point out
what we ought to do, as well as to determine what we shall do.“ Dieser
berühmte Satz wird von John Dinwiddy als irreführend bezeichnet weil der Unterschied
zwischen dem, was ist, und dem, was sein soll im Utilitarismus durchaus verdeutlicht
wird.[16]
Das Nutzenprinzip ist für ihn Ausgangspunkt aller weiteren Überlegungen, und
daher wird eine weitergehende Begründung abgelehnt: „... for what is proof
of every thing else, cannot itself be proved“[17]
Die schwache erkenntnistheoretische Basis seiner Überzeugungen brachte
seinen Schüler John Stuart Mill zu der Aussage: „He was not a great
philosopher, but he was a great reformer in philosophy“.[18]
Die praktische Umsetzung seiner Forderungen war ihm weitaus wichtiger als deren
theoretische Diskussion. Er befaßte sich daher mit zahlreichen Projekten, z. B.
Strafrechtsreform, Gefängnisarchitektur oder Universitätsgründung.[19]
Als Handlungsmaxime stellt Bentham deshalb ein hedonistisches Kalkül auf. Jede Handlung soll danach beurteilt werden, ob sie bei den betroffenen Individuen Leid oder Freude hervorruft. Die Freuden und Leiden können in Dauer und Intensität gemessen werden und über die Individuen saldiert werden[20]. Die Begriffe Freude, Lust und Nutzen werden von Bentham teilweise synonym verwendet. Er stellt jedoch in einer späteren Anmerkung klar, daß das Wort Utility nicht von allen Menschen im Sinne von Lustmaximierung verstanden wird. Er umschreibt seine Nutzeninterpretation daher mit den Worten happiness und felicity [21].
Bentham beschreibt verschieden
Arten von Pleasure. Darunter einige, welche man nicht unbedingt sogleich als
Lust bezeichnen würde, wie etwa die Ausübung einer Religion. Durch die Anerkenntnis
von Lüsten, welche nicht auf kurzfristigen (hedonistischen) Empfindungen
beruhen, nähert er sich einem modernen Nutzenkonzept an. Man denke etwa an
einen Masochisten, der ein Verlangen nach Schmerz hat. Bentham würde jedoch
auch das Verlangen nach Schmerz so interpretieren, daß es letztendlich mehr
Lust bereitet. Lust und Schmerz sind bei
Bentham letztlich eine einheitliche, sensualistisch
definierte Größe.
“Das größte Glück der größten Zahl“ [22] als Ziel menschlichen Handelns wird als bekanntestes Zitat Benthams oft als Kernsatz des Utilitarismus schlechthin betrachtet. Er präzisiert dieses Prinzip jedoch und verlangt nur von der Regierung eine vollständige Unterwerfung unter dieses Prinzip. Einzelne Individuen seien meist nur in der Lage, sich selber zu lenken, während der Staat alle lenken könne. Allerdings geht Bentham von der langfristigen Übereinstimmung individueller und gemeinschaftlicher Interessen aus.
2.3.2 Die subjektive Meßbarkeit von Lust und Schmerz
Die Meßbarkeit von Lust und Schmerz wird von Bentham nicht in objektiver Form untersucht, denn dies würde voraussetzen, daß er eine intersubjektiv vergleichbare Maßeinheit entwickelt. Er stellt aber einige Merkmale heraus, welche den subjektiven Wert von Lust und Schmerz beeinflussen:
1. Its intensity
2. Its duration
3. Its certainity or uncertainity
4. Its propinquity or remoteness[23]
Diese Merkmale bestimmen den Wert einer einzelnen Freude oder eines Schmerzes. Weitere Umstände müssen zur Bewertung herangezogen werden:
5. Its fecundity
6. Its purity
7. Its extent[24]
Mit diesen Merkmalen beschreibt der Utilitarist zwar einige Gründe für Freude und Schmerz und deren Bewertung, eine Operationalisierung für die Messung und den interpersonellen Vergleich wird gleichwohl nicht vorgenommen. In seinem Werk “The Value of Pain and Pleasure“ schlägt er Geld als allgemeinen Maßstab für Nutzen vor. Falls sich mehrere Menschen über ihre Zahlungsbereitschaft für das Erlangen einer Freude oder die Vermeidung eines Schmerzes einig sind, so muß auch der Wert der Freude oder des Schmerzes jeweils gleich sein.[25] Allerdings ist die Zahlungsbereitschaft hier keine wirklich operationale Größe, da der Grenznutzen von Geld abnimmt. Nur unter der theoretischen Annahme einer gleichartigen Position kann Zahlungsbereitschaft zum direkten Nutzenvergleich herangezogen werden. Die objektive Meßbarkeit von Lust und Schmerz wird von Bentham ebenso wie die interpersonelle Vergleichbarkeit vorausgesetzt, jedoch nicht problematisiert. Er scheint beides als unproblematisch und intuitiv lösbar zu betrachten.
2.3.3 Bentham und die Einkommensdistribution
Mit der Saldierung des Nutzens
ist die Verteilungsfrage des Nutzens erledigt. Es gibt keinen Anspruch auf ein
Mindestglück. Die nutzenmaximalen Einkommensverteilung muß aber bestimmt
werden. Verteilung ist dem Greatest-Happiness-Prinzip
nachgeordnet; die Verteilung von Geld ist das bedeutendste Instrument, das der
Regierung zur Verfügung steht: „Money
therefore is the only current possession, the only current instrument of pleasure.
When a
legislator then has occasion to apply pleasure, the only method he has of doing
it, ordinarily speaking, is by giving money.“[26] Von dieser Überlegung ausgehend kommt
Bentham zu der Schlußfolgerung, daß eine Gleichverteilung des Einkommens eigentlich
erstrebenswert sei, weil sie ein Maximum des aggregierten Glücks bewirke. Die
Eingriffe in die Besitzrechte der Reichen und die damit verbundene Zerstörung
von Leistungsanreizen müssen jedoch auch bedacht werden, sie werden als „second- and third effects“ bezeichnet.
Daher würde eine völlige Gleichheit der Einkommen alle Leistungsanreize
zerstören und nicht zum gesellschaftlichen Nutzenmaximum führen. Die Summe des
zu verteilenden Gesamteinkommens würde einfach schrumpfen. Damit verwirft er
die Idee staatlicher Verteilungspolitik sogleich wieder, ohne eine Maximierungsfunktion
zu entwickeln, die den Trade-off zwischen Effizienz und Gerechtigkeit zugleich
berücksichtigt.[27]
In der Praxis hat Bentham sich
lange mit der Armengesetzgebung beschäftigt. Er wollte ein Musterarmenhaus
bauen und betreiben. Eine ähnliche Idee hatte er für ein Panopticon genanntes Mustergefängnis. Hierzu brachte er auch eine
Gesetzesvorlage ins Parlament ein. Die Ablehnung seiner Vorschläge war Anlaß
für seine Schriften, die sich kritisch mit dem Funktionieren von Gesetzgebung
und Verwaltung befassen[28].
Die Idee, staatliche Aufgaben an Privatunternehmer zu vergeben und diesen bestimmte
Ziele vorzugeben und sie daraufhin zu kontrollieren, ist heutzutage wieder sehr
verbreitet, und in den USA gibt es private Betreibergesellschaften für
Gefängnisse.
2.4 John Stuart Mill
John Stuart Mill ist von seinem
Vater James Mill und von Jeremy Bentham von klein auf im Geiste des Utilitarismus
erzogen worden. Außerdem ist sein Denken stark von Comte und Saint-Simon
beeinflußt worden.[29]
Seine „Grundsätze der Volkswirtschaftslehre“ waren das ökonomische Standardwerk
vor dem Siegeszug der Neoklassik.
2.4.1 Grundlagen des utilitaristischen Liberalismus
Der Utilitarismus könnte prinzipiell auch von Diktatoren zur Rechtfertigung ihrer Herrschaft benutzt werden, indem sie behaupten, es ginge den Menschen unter ihrer Herrschaft besser oder diese wüßten nicht, was für sie gut sei. Mill begründet dagegen in seinem Werk „On Liberty“ bürgerliche und soziale Freiheit auf utilitaristischer Grundlage. Sogar ein vortrefflich gebildeter und wohlwollender Herrscher kann sich nicht sicher sein, ob seine Auffassungen wirklich richtig sind: „Wenn jemand einer Meinung das Gehör verweigert, weil er überzeugt ist, daß sie falsch sei, so setzt er voraus, daß seine Überzeugung gleichbedeutend mit absoluter Sicherheit sei.“ [30] Mill führt einige Beispiele älterer Theorien an, welche sich ebensolche Unfehlbarkeit anmaßten und später widerlegt wurden. Das Christentum war in Mills Jahrhundert die fast allgemein befolgte Moraltheorie. Mill zeigt, das es zuvor mit den gleichen Argumenten bekämpft wurde, mit denen einige seiner Vertreter nun andere Auffassungen bekämpfen. Sein Eintreten für absolute Meinungsfreiheit führt zu seiner berühmten Aussage: „Wäre die ganze Menschheit einer Meinung und nur ein einziger Mensch der gegenteiligen Ansicht, so hätte die Menschheit nicht mehr Recht, ihn zum Schweigen zu verurteilen, als er das Recht hätte, die Menschheit zum Schweigen zu bringen.“[31] Der freie Vergleich aller Auffassungen ist für das Wohlbefinden der Menschheit unabdingbar, die Freiheit des Einzelnen und die Respektierung seiner Individualität ist für den Nutzen des Individuums zwingend erforderlich. Nicht nur ein absoluter Herrscher, sondern auch die kollektive Mittelmäßigkeit demokratischer Mehrheiten ist eine Gefahr für die Freiheit des Individuums.
2.4.2 Mills qualitativer Utilitarismus
Das Nutzenprinzip übernimmt Mill
von Bentham und verteidigt es in seinen Schriften. Dabei wird das ursprüngliche
Prinzip jedoch in zahlreichen Aspekten modifiziert. Insbesondere versucht Mill,
neben der Quantität einer Lust, meßbar durch das hedonistische Kalkül , auch deren Qualität zu berücksichtigen. Nur
ein gebildeter und erfahrener Mensch ist in der Lage, die verschiedenen Genüsse
zu beurteilen, da er sie kennt und in ihren langfristigen Wirkungen beurteilen
kann: „ ... wobei der Maßstab, an dem die
Qualität gemessen und mit der die Quantität verglichen wird, die Bevorzugung
derer ist, die ihrem Erfahrungshorizont nach - einschließlich Selbsterfahrung
und Selbstbeobachtung - die besten Vergleichsmöglichkeiten besitzen.“ [32]
2.4.3 Mills sozialer Liberalismus
Seine Auffassungen zur
Sozialpolitik hat Mill nicht in einem Werk mit politischem Programmcharakter
zusammengefaßt. Eine Schrift, die wie On
Liberty, Utilitarianism oder The Subjection
of Woman, auch dieses Thema zusammenhängend betrachtet und die durchdachte
Reformansätze präsentiert, existiert nicht. Dies mag daran liegen, daß Mill in
dieser Thematik stärkeren Schwankungen seiner Meinungen unterlag, und es ihm
schwerer fiel, seine Ideen in sein Gedankengebäude widerspruchsfrei zu
integrieren. Dennoch lassen sich aus seinen Briefwechseln, seiner Steuertheorie
und seinen
Äußerungen zur „Poor-Law Reform“ Konzepte
einer erstaunlich modernen Sozialpolitik erkennen[33].
In der Steuertheorie tritt Mill für ein steuerfreies Existenzminimum ein. Die in seiner Zeit übliche hohe Verbrauchssteuer auf Nahrungs- und Genußmittel kritisierte er wegen ihrer regressiven Verteilungswirkung. Mill war einer der Vordenker der Opfertheorie der Besteuerung, mit der sich insbesondere progressive Einkommensteuern rechtfertigen lassen. Sie leitet sich aus einem abnehmenden Grenznutzen von Einkommen direkt ab. Die Möglichkeiten einer umfassenden Einkommensteuer schätzte Mill jedoch nicht optimistisch ein, was beim damaligen Stand der Finanzverwaltung vermutlich realistisch war. Daher rückt er die Betrachtung der Verbrauchssteuern stärker in den Vordergrund. Insbesondere für Luxusgüter ist aus utilitaristischer Sicht eine hohe Besteuerung angebracht. Der Luxuskonsum schafft nur geringen Nutzen – Mill nähert sich hier der Adam Smith-Nutzenillusion von Luxus – und kann daher schadlos besteuert werden. Oft erfolgt sogar Statuskonsum, der gar keinen Nutzen stiften kann, da er nur durch seine relative Position wirkt, diese sich aber durch anteilsmäßige Besteuerung nicht verschiebt (Mill erkennt hier also einen Veblen-Effekt).
Desweiteren tritt Mill für Chancengleichheit ein. Insbesondere der Zugang zu Bildungseinrichtungen sollte auch Einkommensschwachen eröffnet werden, wenn sie ihn sich durch Leistung verdienen. Die Besteuerung von Erbschaften und deren gleichmäßige Aufteilung durch einen individuellen Höchstbetrag für empfangene Erbschaft werden im Sinne einer Wohlfahrtssteigerung befürwortet.
In der eigentlichen Sozialpolitik war Mill zunächst stark von der Bevölkerungslehre von Malthus geprägt. Danach ist jede Hilfe für die Armen kontraproduktiv, da sie nur zu einer Zunahme der Bevölkerung führt. Später glaubte Mill jedoch, daß durch eine Hebung des Bildungsniveaus auch das Bevölkerungswachstum gebremst werden könne. Die soziale Situation zu Beginn des Schaffens von Mill war durch den verbreiteten Pauperismus geprägt. Auch Menschen, die Arbeit hatten, lebten am Rande des Existenzminimums, Landflucht führte zu Verslumung der Industriestädte, lange Arbeitszeiten, Kinderarbeit etc. waren an der Tagesordnung. Ein Problem der Armenfürsorge sah er daher darin, daß sie den Neid der Arbeiter erwecken müsse. Den Arbeitsunfähigen zu helfen, ohne Arbeitsanreize zu zerstören, war daher das Grundanliegen von Mills Vorschlägen zur Sozialpolitik. Die Gewährung von Unterstützung an Arbeitsfähige sollte daher in Arbeitshäusern erfolgen, deren Bedingungen mindestens so unangenehm und hart sein sollten wie die der schlechtesten Arbeit auf dem freien Markt.
Mills Ansichten über den Sozialismus wandelten sich mehrfach. Anfangs ganz von der reinen Lehre der Klassiker überzeugt, machte er schon früh eine Phase durch, die als Saint-Simonistisch bezeichnet werden kann. Die Geschichtstheorie, welche die Gesellschaftsordnungen als historische Phasen betrachtet, ließ auch Mill davon ausgehen, daß der frühkapitalistische Zustand der Gesellschaft nur ein Übergang sei. Er verteidigte jedoch immer die heilsame Wirkung des Wettbewerbs für Wachstum und individuelle Freiheit. Für eine Ausreifungsphase, in der Wachstum weniger relevant sein wird, stellt Mill sich eine Wirtschaftsordnung vor, in der insbesondere Genossenschaften eine größere Rolle spielen als Privateigentum. Aus Mills späteren Überlegungen zu folgern, er sei am Ende Sozialist geworden, ist vermutlich nicht richtig. Seine Konzeption kann man eher als soziale Marktwirtschaft bezeichnen[34].
2.5 Handlungs- und Regelutilitarismus in der institutionenökonomischen Betrachtung
Die Unterscheidung zwischen Handlungsutilitarismus und Regelutilitarismus ist ein wesentliches Element der weiterführenden Diskussion über die Nützlichkeitslehre, nachdem die Klassiker ihre Grundlagen formuliert hatten. Dabei gilt Bentham als Vorläufer der Handlungsutilitaristen und Mill als Vorläufer der Regelutilitaristen[35].
2.5.1 Der Handlungsutilitarismus
Die ethische Beurteilung einer jeden Handlung wird nur nach ihren Folgen gemäß des hedonistischen Kalküls beurteilt. Dieser Standpunkt wird als teleologische Ethik bezeichnet, weil er ausschließlich zielorientiert und ergebnisbezogen beurteilt. Ein Beispiel soll diese Position verdeutlichen: Ein Richter hat die Möglichkeit, entweder einen Unschuldigen zu verurteilen oder ihn freizusprechen, damit aber Unruhen auszulösen, die viele Menschen das Leben kosten würden. Ein Handlungsutilitarist würde es in dieser Situation für seine moralische Pflicht halten, den Unschuldigen zu verurteilen, um das Leid, das die Unruhen verursachen würden, zu verhindern. Lediglich Faustregeln würde er gutheißen, da es aus Nützlichkeitsüberlegungen nicht immer möglich ist, alle möglichen Folgen tatsächlich zu evaluieren. Auch der Aufwand der Informationsbeschaffung unterliegt natürlich einem Nutzenkalkül[36].
2.5.2 Der Regelutilitarismus
Der Regelutilitarismus weist eine
große Nähe zum kategorischen Imperativ
Kants auf. Nicht die einzelne Handlung soll mit einem hedonistischem Kalkül
beurteilt werden, sondern die Folgen, welche eintreten würden, falls alle Individuen
in einer bestimmten Situation auf die gleiche Weise handeln würden. Eine Handlung ist dann gerechtfertigt, wenn
sie einer moralischen Regel folgt, lediglich die Nützlichkeit der Regeln wird
auf utilitaristische Weise untersucht.
2.5.3 Vergleich der beiden Varianten des Utilitarismus
Die utilitaristische Ethik wird
in der philosophischen Analyse in zwei Bestandteile zerlegt, in den Hedonismus und den Konsequenzialismus. Letzterer wird auch als Zweckethik oder
Verantwortungsethik bezeichnet, weil nicht der gute Wille zählt, sondern das
gute Ergebnis einer Handlung. Theorien, die bestimmten Regeln intrinsische Werte zuordnen, also sie a
priori als "gut" definieren, bezeichnet man im Gegensatz dazu als deontologisch.
Die Untersuchung regelgebundenen Handelns ist in Rahmen der neueren Institutionenökonomik in den Fokus wirtschaftswissenschaftlicher Betrachtung geraten. Für zahlreiche Entscheidungssituationen empfiehlt es sich, nach Regeln zu handeln, weil andere Akteure die Reaktionen ihres eigenen Handelns dann antizipieren müssen. Mit Hilfe spieltheoretischer Methoden lassen sich ein- und mehrzügige Spielsituationen unterschiedlich analysieren. Nach einem rein handlungsutilitaristischen Kalkül würde eine Strafe für Mord keinen Sinn machen, wenn man die Situation als einmalig betrachtet. Dem Täter wird Schaden zugefügt, das Opfer hat jedoch keinen Nutzen mehr davon. Betrachtet man jedoch die langfristigen Effekte, so kann die Strafe spätere Morde verhindern, und eine Bestrafungsregel daher durchaus die Nutzensumme erhöhen. Diesen Prozeß der Regelfindung beschreibt Harsanyi: „First we must define the rigt moral rule as the moral rule whose acceptance would maximise expected social utility in simular situations. Then we must define a morally right action as one in compliance with that rule.“[37] Auch Regelutilitaristen wollen ihre Regeln mit Hilfe des hedonistischen Kalküls beurteilen. Sie müßten daher ihre Regeln so formulieren, daß sie Ausnahmesituationen möglichst berücksichtigen. Die Regel „Verurteile keine Unschuldigen“ müßte im oben genannten Beispiel auch um den Zusatz erweitert werden „es sei denn, daß sonst Massaker ausbrechen“. Wendet man das hedonistische Kalkül überhaupt an, so müssen die allgemeinen Regeln mit dem handlungsutilitaristischen Ansatz letztlich langfristig übereinstimmen. Beurteilt man die Regeln nur anhand hypothetischer Folgen ohne jenes Kalkül, sollte man überhaupt nicht von den Standpunkt nicht als utilitaristisch bezeichnen. Der Gegensatz zwischen Handlungsutilitarismus und Regelutilitarismus löst sich entweder in das Problem der Betrachtung auch langfristiger Folgen einer Handlung auf oder der Regelutilitarismus „kapituliert vor Kant“[38]. Einen solchen deontologische Theorieansatz sollte man jedoch nicht mehr utilitaristisch nennen.
2.5.4 Präferenzutilitarismus versus sensualistischer Utilitarismus
In der ursprünglichen Formulierung von Bentham hängt die Wohlfahrt ausschließlich von Lust im positiven und Schmerz im negativem Sinne ab, wobei diese letztlich einheitliche Größen sind. Es werden zwar verschiedene Ursachen unterschieden, jedoch ist jede Freude gleich zu bewerten, egal woraus sie resultiert.
Die Gegenposition dazu besteht in
der Überlegung, daß Freuden nicht zwangsläufig eine einheitliche Größe sein
müssen. Die Freude aus dem Genuß eines gut gekühlten Kölsch kann gänzlich anderer
Art sein als die Freude, die man dabei empfindet, wenn das eigene Kind laufen
lernt. In diesem Sinne wird
Freude und Schmerz allgemeiner definiert „...pleasure as an experience (or
an aspekt of expierience) that one likes or that one wishes to continue on ist
own account. Pain is an experience that one dislikes an wishes to cease.”[39]
Die Frage, ob Wünsche aus Lust oder Schmerz entstehen, oder ob Lust
oder Schmerz aus der Befriedigung von Wünschen entstehen, lässt sich in den
Bereich der Psychologie verbannen; die ökonomische Betrachtung kann dann wie
immer von geäußerten Präferenzen ausgehen. Bei speziellen Fragen, insbesondere
widersprüchlichen Präferenzen oder Metapräferenzen (Präferenzen über
Präferenzen), muß jedoch hinter diese Annahme zurückgegangen werden. Beispiel
ist die ökonomische Analyse von Suchtverhalten, also einer kurzfristigen
Präferenz für eine Droge, welcher der langfristige Wunsch gegenübersteht,
gerade diese Präferenz nicht mehr zu haben. Benthams Determinanten für den Wert
einer Freude können erklären, warum langfristige, reine Freuden denjenigen
vorzuziehen sind, welche kurzfristig und mit folgenden Schmerzen verbunden
sind.[40]
2.6 Neoklassik und ältere Wohlfahrtstheorie
2.6.1 Der Einfluß des Utilitarismus auf die Neoklassik
Inwieweit der Utilitarismus in die Neoklassik und die ältere Wohlfahrtsökonomik einging, ist umstritten. „Der Utilitarismus ging weder in die klassische Schule der Nationalökonomie ein, noch war er Ausgangspunkt der Grenznutzenschule[41], behauptet Jochen Schumann in einem Standardwerk zur Theoriegeschichte der Nationalökonomie. Da sowohl Bentham als auch Mill als bedeutende Vertreter der klassischen Schule eine enge Verbindung zwischen Ethik und Ökonomie gepflegt haben, ist der erste Teil von Schumanns Aussage offensichtlich unzutreffend. Ob die Grenznutzentheorie Gossens von Bentham beeinflußt wurde, ist umstritten[42], wenn man seine Formulierungen betrachtet, jedoch nicht unwahrscheinlich: „Der Mensch richte seine Handlungen so ein, daß die Summe seines Lebensgenusses ein Größtes werde.“[43] Um die Summe der Lebensgenüsse zu maximieren, wendet Gossen als erster eine Grenzwertbetrachtung an.
Von den Vätern der Neoklassik ist insbesondere Jevons als eindeutiger Vertreter des Utilitarismus zu nennen. Er verteidigte die ursprüngliche Position Benthams gegen alle Modifikationsversuche in Richtung eines qualitativen Utilitarismus. Dies begründet er damit, daß sich die Ökonomie nur mit den niederen, auf Konsum und Erwerb ausgerichteten Handlungsmotiven zu befassen habe. Die naturalistische Begründung des Utilitarismus führt Jevons zum Erarbeiten seiner anthropologischen Grundlagen[44].
Obwohl die Neoklassik teilweise aus utilitaristischem Gedankengut hervorgegangen ist, kam es in ihrem Gefolge zu einer Entleerung des Nutzenbegriffs, d.h. es wird alles aus ihm verbannt, was nicht mathematisch zu beschreiben ist.
2.6.2 Edgeworth und die Suche nach der Nutzeneinheit
Auch F. Y. Edgeworth zählt zu jenen Gründungsvätern der Neoklassik, die stark vom Uilitarismus beeinflußt worden sind. Er beschäftigt sich mit den Werken von Bentham, Mill und Sidgwick und wirft den letzteren zwei Denkern vor, sie hätten über die Frage der Nutzenmessung eher Verwirrung gestiftet. Sein Hauptwerk „Mathematical Psychics“ beschäftigt sich mit der Anwendung mathematischer Methoden auf die Moralwissenschaften, also auch auf die heutigen Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Sein ehrgeiziges Projekt zur mathematischen Handhabung utilitaristischer Kalküle bezeichnete Edgeworth als Hedonimetry.[45] Um Nutzen zu messen und damit auch interpersonell vergleichbar zu machen, bedarf es daher einer Maßeinheit. Nutzen hat zwei Dimensionen, Intensität und Dauer. Edgeworth versucht darauf die Nutzeneinheit als kleinste noch wahrnehmbare Nutzenmenge zu definieren. Diese „atoms of pleasure“ kann er jedoch nicht greifbar machen. Weder ist mit der kleinsten Wahrnehmung eines Nutzens impliziert, daß es keine kleineren Einheiten unterhalb der direkten Wahrnehmbarkeit gibt, noch klärt er, warum diese wahrnehmbare Einheit bei allen Individuen gleich groß sein soll. Edgeworth führt das Konzept auch nicht wirklich weiter, sondern arbeitet mit ordinalen oder auch relativen Nutzengrößen weiter.[46]
2.6.3 Die ältere Wohlfahrtstheorie
Mit dem Begriff „ältere Wohlfahrtstheorie“ werden jene Untersuchungen über die gesellschaftliche Wohlfahrt bezeichnet, die von folgenden Grundannahmen ausgehen:
1.) Nutzen ist in Geldeinheiten meßbar und ein Maß für soziale Wohlfahrt.
2.) Der Nutzen ist interpersonell vergleichbar und aggregierbar.
Die Annahmen dieser Theorie
werden als subjektivistisch-utilitaristisch bezeichnet. Von den bedeutendsten
Vertretern dieser Theorie hat sich Alfred
Marshall vor allem mit der Partialanalyse einzelner Märkte befaßt. Er geht
davon aus, daß für eine Totalanalyse aller Nutzen und des mit ihrer Produktion
verbundenen Arbeitsleids die Meßbarkeit nicht gegeben sei. Auf einzelnen
Märkten lasse sich aber der Nutzenüberschuß mit Hilfe der Konsumentenrente
messen. Die Konsumentenrente, die bei einem Individuum anfällt, ist definiert
als die Differenz aus seiner Zahlungsbereitschaft und dem Preis, den es am
Markt für das jeweilige Gut tatsächlich bezahlen muß. Marshall geht dabei davon
aus, daß die Konsumenten auf einem einzelnen Markt gewöhnlich der gleichen
Einkommensklasse angehören.[47]
Das Standardwerk der älteren Wohlfahrtsökonomik ist „The Economics of Welfare“ von Arthur Cecil Pigou. Wie auch Marschall will er nur Veränderungen des gesellschaftlichen Wohlstandes messen, die sich in Geldeinheiten ausdrücken lassen. Er behauptet außerdem, seine Theorie sein rein deskriptiv und enthalte keine normativen Elemente. Er betrachtet das Volkseinkommen als objektives Wohlfahrtsmaß, das lediglich inflationsbereinigt werden muß. Die Analyse von Konsumentenrenten betreibt er nicht weiter, obwohl er sie zur Messung der Intensität von Güterwünschen für geeigneter hält. Pigou nimmt an, daß in allen Produktionsprozessen einer Gesellschaft abnehmende Grenzprodukte des Einsatzes eines Faktors existieren, d. h. das Volkseinkommen kann maximiert werden, wenn der Ausgleich der sozialen Grenzprodukte erreicht wird. Außerdem sind die externen Effekte einer Produktion zu berücksichtigen und zu saldieren.
Bei der Untersuchung von
Verteilungswirkungen geht Pigou von einem gegebenen, fixen Niveau des Volkseinkommens
aus. Das Volkseinkommen als Wohlfahrtsmaß wird also doch relativiert. (Falls die
Verteilung nicht
berücksichtigt würde, könnte auch eine Verteilung optimal sein, in der
fast das ganze Volkseinkommen alleine von einem Herrscher verbraucht würde,
während alle anderen Menschen nur das Existenzminimum bekämen – eine Situation,
die wohl kaum jemand als Wohlfahrtsmaximum akzeptieren würde.). Der Ausgleich
der privaten Grenznutzen führt ebenso wie der von sozialen Grenzprodukten zum
Nutzenmaximum. Wenn man von abnehmenden Grenznutzen des Einkommens ausgeht
sowie von Individuen, die identische Nutzenfunktionen über Einkommen haben, so
wird bei einer Gleichverteilung von Einkommen der höchste Gesamtnutzen für die
Gesellschaft erreicht. In Abb. 1 ist die Grenznutzenfunktion von Individuum A
von links nach rechts abgetragen, die von Individuum B von rechts nach links.
In der ursprünglichen Verteilungssituation (eorg) kann durch
Verteilung von Einkommen von dem wohlhabenderen Individuum A an Individuum B
zusäzlicher Nutzen geschaffen werden. Dies ist solange möglich, bis Gleichverteilung
des Einkommens bei (eopt) erreicht ist. Die gerasterte Fläche gibt
den Nutzengewinn durch die Umverteilung an. Die Annahme eines unveränderten
Gesamteinkommens ist jedoch in hohem Maße unrealistisch, wenn man die
Anreizeffekte der Umverteilung und die Excess Burden der Besteuerung
mitberücksichtigt. Auch die Unterstellung identischer Nutzenfunktionen ist
kritikwürdig, weil unterschiedliche Präferenzen über Einkommen und Freizeit
existieren können und auch empirisch nachweisbar sind.
|
|
|
Abb. 1 Ausgleich der Grenznutzen von
Einkommen
Quelle: SCHERNIKAU, S. 71 |
2.6.4 Werturteilsstreit und Kritik der älteren Wohlfahrtstheorie
Die Kritik der älteren Wohlfahrtstheorie fällt zusammen mit der Auseinandersetzung um die Zulässigkeit von Werturteilen in der Ökonomie. Bereits John Stuart Mill trennt in seinem wissenschaftstheoretischen Hauptwerk "A System of Logic" normative und positive Aussagen. Allerdings ist die Trennung und Kenntlichmachung der unterschiedlichen Teile einer wissenschaftlichen Theorie zur Zeit der Klassik nicht besonders ausgeprägt worden. Die Ökonomie hatte sich aus philosophischen Erwägungen entwickelt und blieb eng mit jenen verbunden. Die Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden auf die „Moral-Science“ und damit der Ausbau der Ökonomie zur positiven Wissenschaft war zunächst nur Programm. Der Methodenstreit zwischen den Vertreter der Neoklassik und der historischen Schule führte zu einer verschärften Auseinandersetzung um die Rolle von Werturteilen in den Sozialwissenschaften. Max Weber formulierte die heute weitgehend akzeptierten Trennung von Werturteilen und wissenschaftlichen Aussagen. Erstere sind subjektiv und letztlich nur auf Glauben begründet. Religiöse Überzeugung und spekulative Betrachtungen über Wesen und Sinn der Welt sind letztlich nicht überprüfbar.
Wissenschaftliche Aussagen gründen sich hingegen auf Logik und empirisch überprüfbare Tatsachen und haben daher interpersonelle Gültigkeit.[48] Die Möglichkeiten einer positiven Sozialwissenschaft wurden von Karl Popper weiterentwickelt zur Wissenschaftstheorie des Kritischen Rationalismus. Ziel der wissenschaftlichen Forschung ist es dabei, allgemeine gesetzmäßige Aussagen zu machen. Dabei kann auch eine mehrfache Überprüfung niemals die Richtigkeit einer Hypothese beweisen. Eine einmalige Abweichung widerlegt dagegen eine Theorie. Theorien können daher niemals verifiziert, wohl aber falsifiziert werden. Auch eine kritisch rationale Wissenschaft hat immanente Wertbezüge. Zunächst ist die Entscheidung für eine Methode ein Werturteil. Weitere liegen in der Auswahl der behandelten Forschungsprobleme, der forschungstechnischen Realisierung und der Verwendung der Ergebnisse. Eine besondere Bedeutung kommt in der Ökonomie dem Wesen ihrer Annahmen zu.[49]
Insbesondere die nutzentheoretischen Grundlagen der älteren Wohlfahrtstheorie wurden von Vilfredo Pareto einer scharfen Kritik unterzogen. Er legte dar, daß die Analyse konkurrenzwirtschaftlicher Tauschvorgänge mit einem ordinalen Nutzenkonzept ebenso durchführbar ist. Der erste Hauptsatz der paretianischen Wohlfahrtstheorie lautet: Konkurrenzgleichgewichte sind Pareto-Optimal. In diesem Zustand kann kein Individuum mehr bessergestellt werden, ohne ein anderes schlechter zu stellen, und von keinem Gut kann mehr produziert werden, ohne die Produktion eines anderen Gutes einzuschränken.[50]
Pareto vertritt die Auffassung, daß Nutzen nicht interpersonell vergleichbar seien. Das Paretokriterium wird dabei nicht allein zur Beurteilung allokativer Fragen herangezogen, sondern als Wohlfahrtskriterium schlechthin benutzt. Basierend auf dem paretianischen Werturteil entstand eine Wohlfahrtstheorie, innerhalb derer kein Optimalzustand angestrebt wird, sondern die jeweiligen Maßnahmen dann positiv beurteilt werden, wenn sie eine Paretoverbesserung bewirken. Der Vorteil der paretianischen Wohlfahrtstheorie besteht darin, daß Pareto-Verbesserungen in hohem Maße konsensfähig sind. Ausdruck dieser Auffassung ist die Wicksellsche Einstimmigkeitsregel, nach der Verteilungsentscheidungen einstimmig getroffen werden sollen.
Der Anwendungsbereich ist jedoch stark eingeschränkt, dennn nur wenige wirtschaftspolitische Maßnahmen führen zu eindeutigen Verbesserungen für alle. Zumeist gibt es Gewinner und Verlierer, deren Interessen irgendwie beurteilt werden müssen, wenn nicht auf alle Maßnahmen verzichtet werden soll. Auf der Grundlage paretianischer Wohlfahrtstheorie entstanden deshalb Kompensationskriterien. Diese führen jedoch zu zahlreichen Paradoxien oder sie setzen doch Werturteile über Verteilung voraus, wie das Samuelson-Kriterium. Damit wird jedoch der Rahmen paretianischer Theorie verlassen und es zeigt sich, daß ohne kardinale Meßbarkeit und interpersoneller Vergleichbarkeit Fragen der distributiven Ökonomik letztendlich nicht zu beantworten sind.[51]
2.6.5 Die Nutzentheorie von Pareto
Die Äußerungen von Pareto zur Nutzentheorie sind jenen von Edgeworth sehr ähnlich. Er geht zunächst von einem kardinalen Nutzenkonzept aus und definiert den Nutzen, den er Ophélimité nennt, als Pleasure, die aus dem Konsum eines Gutes entsteht. Wenn man eine infinitesimal kleine Menge des Gutes betrachtet, und den Nutzen, den sie stiftet durch die Menge dividiert, so erhält man die Ophélimité Élémentaire, welche man heute als Grenznutzen bezeichnen würde. Wenn man diese wiederum durch den Preis des Gutes dividiert, so erhält man die Ophélimité Élémentaire Ponderée.[52] Diese kann als der gewichtete Grenznutzen eines Gutes definiert werden, also als die Zunahme des Gesamtnutzens, die aus der Verwendung einer Geldeinheit für das Gut entsteht. Pareto weist dann darauf hin, daß diese Einheiten für Nutzen nicht eindeutig definiert werden können. Die kardinale Meßbarkeit hält er ebenfalls für fragwürdig. Für die Formulierung von Modellen, die das Marktgeschehen abbilden und um ein allgemeines Tauschgleichgewicht zu formulieren, ist ein ordinales Nutzenkonzept ausreichend. Paretos Ablehnung der klassischen Wohlfahrtsökonomik folgt aus diesen Überlegungen jedoch nicht. Diese ist vermutlich politisch motiviert.
2.6.6 Exkurs: Paretos politische Theorie
Pareto steht in seiner politischen Theorie den ethischen
Auffassungen des Utilitarismus ablehnend gegenüber. Obwohl er in
Wirtschaftsfragen liberale Ansichten vertrat , hielt er nicht viel von der “demokratischen Religion.”
Nach Paretos Überzeugung ist das Handeln der Menschen überwiegend von unlogischen Faktoren bestimmt. Er teilt sie ein in die konstanten Residuen und die veränderlichen Derivate. Zu den Residuen zählt er den Kombinationsinstinkt (Denkfähigkeit), Gruppenbeharrung, Permanenz der Abstraktionen (das Bedürfnis nach Symbolen), die individuelle Integrität (Eigeninteresse) und den Sexualtrieb. Die Derivate sind scheinlogische Verkleidungen, die zur Rechtfertigung und Verhüllung der eigentlichen Antriebe der Menschen benutzt werden. Dazu zählen Religionen, Weltanschauungen, Konventionen, politische Theorien etc. Sie können auf verschiedenen Grundlagen erzeugt werden, z.B. durch Berufung auf Autorität, auf Abstraktion, dogmatische Behauptung und scheinlogische Beweise durch Begriffsverwirrungen.[53]
Aus diesen Annahmen entwickelt Pareto seine Theorie der Elitenzirkulation. Er folgt den Begriffen Machiavellis und teilt die Elite in instinktstarke “Löwen” und kluge aber instinktschwache “Füchse” ein. Die Masse folgt der Elite und wird durch Gruppenbeharrung gelenkt. In der Gründungsphase einer Gesellschaft überwiegen die kriegerischen und gläubigen “Löwen”, wenn die Gesellschaft ausreift und sich normalisiert gewinnen die “Füchse” Einfluß auf die Regierung. Dadurch wird die Elite langfristig geschwächt und korrupt; sie verläßt sich auf Tricks und Kuhhandel und verliert den Willen zur Gewaltanwendung. Irgendwann wird sie daraufhin von einer neuen Schicht von “Löwen” gestürzt. Pareto entwickelt daraus ein Konzept der geplanten Elitenzirkulation, um solche Erschütterungen zu vermeiden.[54]
3. Moderne Wohlfahrtstheorien
3.1 Kardinale Nutzenmessung
Häufig wird kardinale Meßbarkeit von Nutzen als Annahme bezeichnet. Die Meßbarkeit ist grundsätzlich eine Eigenschaft einer Sache. Weil jedoch die Messung mit zahlreichen Schwierigkeiten verbunden ist, macht es Sinn, darzulegen, ob eine ökonomische Theorie kardinale Nutzenmessung braucht, oder ob ordinal geäußerte Präferenzen ausreichend sind.
3.1.1 Marschaks axiomatischer Ansatz
Ausgehend von der kardinalen Nutzenfunktion, die von Neumann und Morgenstern 1947 aufgestellt haben, um rationales Verhalten unter Unsicherheit zu erklären, hat Marschak Rationalitätspostulate aufgestellt:
1. Transitivitätspostulat
Die betrachteten Individuen haben eine vollständige und transitive Präferenzordnung.
2. Kontinuitätspostulat
Wenn das Wirtschaftssubjekt einen unsicheren Zustand A gegenüber einem sicheren Zustand B präferiert und diesen wiederum einem Zustand C, so gibt es Eintrittswahrscheinlichkeiten (P) für A und (1-P) für C, bei denen das Individuum gegenüber dem sicheren Ereignis B indifferent ist. (Abb.2)
3. Ausreichende Anzahl
Es gibt mindestens vier verschiedene Zustände, zwischen denen keine Indifferenz herrscht.
4. Unabhängigkeitspostulat
Besteht zwischen A und A´ Indifferenz und ist B ein beliebiger weiterer Zustand, so gibt es zwei äquivalente Wahrscheinlichkeitsmischungen für A und B sowie für A´ und B.[55]
3.1.2 Messung individueller Wertfunktionen
Falls die Präferenzen eines Individuums den Rationalitätsanforderungen genügen, ist es möglich, durch bestimmte Methoden eine kardinale Wertfunktion zu ermitteln. In der Regel werden Präferenzen nur ordinal geäußert, d.h. es genügt in der überwiegenden Zahl der Entscheidungsituationen, die jeweils vorteilhafteste Alternative auszuwählen. Über die Abstände zwischen dem Nutzen, den die einzelnen Alternativen liefern, braucht man dann nicht unbedingt Klarheit zu schaffen. Mit Hilfe der Abfragetechniken ist es dennoch möglich, den Individuen ihre Präferenzen auch in kardinal skalierbarer Weise zu entlocken.
3.1.2.1 Direct Rating
Bei diesem Verfahren verteilen die Individuen Punkte für einzelne Alternativen. Die Bewertungen können dann noch zwischen den Werten Null (für die schlechteste Alternative) und Eins (für die beste Alternative) normiert werden. Die Normierung setzt allerdings voraus, daß die besten und schlechtesten Zustände eindeutig definierbar sind. Falls die Präferenzen einfach in Punkten auszudrücken sind, so kommt dies den Vorstellungen des klassischen Utilitarismus schon recht nahe. Jedoch genügen die auf diese Art abgefragten Präferenzen leider nicht immer den Rationalitätsanforderungen, insbesondere sind häufig Konsistenzprüfungen nicht erfolgreich.
3.1.2.2 Die Methode gleicher Wertdifferenzen (Difference Standard Sequence Technique)
Ausgehend von der schlechtesten
Alternative (A) wird ein willkürlich ausgewählte bessere Alternative (B) betrachtet.
Dann wird eine Alternative (C) gesucht, für welche gilt, daß der Nutzengewinn
des Übergangs von A nach B gleich jenem von B nach C ist. Auf diese Weise
lassen sich weitere Alternativen finden, zwischen denen gleiche Wertdifferenzen
bestehen. Dieses Verfahren setzt eine hinreichend große Anzahl von Alternativen
voraus. Diese Voraussetzung ist in der Regel unproblematisch, da in der Grenznutzentheorie
infinitesimale Teilbarkeit der Güter angenommen wird. In der Praxis wird man
kardinale Nutzenkonzepte in der Regel auf kontinuierlich darstellbare Güter
(z.B. Einkommen, Freizeit) beziehen. Der Vorteil in der Methode gleicher Wertdifferenzen
liegt darin, daß der Entscheider nur
Indifferenzaussagen zu treffen braucht. Es ist also möglich, aus ordinal geäußerten
Präferenzen eine kardinale Nutzenfunktion zu konstruieren.
3.1.2.3 Die Halbierungsmethode (Midvalue Splitting Technique)
Bei dieser Methode wird zuerst die beste und die schlechteste Alternative bestimmt. Im zweiten Schritt wird eine Alternative gesucht, welche wertmäßig genau in der Mitte zwischen den beiden Alternativen liegt. Zwischen dieser Alternative mit dem Wert 0,5 und den anderen beiden läßt sich das Verfahren wiederum durchführen und man kann Alternativen mit 25% und 75% des Wertes der bestmöglichen Alternative finden. Auf diese Weise lassen sich beliebig viele Stützpunkte der Wertfunktion ermitteln. Diese Methode hat ähnliche Vor- und Nachteile wie die zuvor beschriebene. Außerdem muß nicht nur die schlechteste sondern auch die beste Alternative eindeutig feststehen.[56]
3.1.3 Risikonutzenfunktion und kardinale Nutzenmessung
Die Frage, ob der Risikonutzenfunktion tatsächlich ein kardinales Nutzenkonzept zugrunde liegt, ist umstritten. Aber schon in der ersten Formulierung der Risikonutzentheorie durch von Neumann und Morgenstern wird deutlich gemacht, daß sie auf die ältere Formulierung einer kardinalen Nutzentheorie zurückgreifen.[57]
Es wurde jedoch auch z. B. von Friedman und Savage die Ansicht vertreten, daß die Risikonutzenfunktion nur ein Ausdruck der Risikopräferenzen der Individuen sei: " It is entirely unnecessary to identify the quantity that individuals are interpreted as maximising (in the case of choices involving risk) with the quantity that should be given special importance in public policy".[58]
Notwendig im Sinne von logisch
zwingend ist die Annahme der gleichen Nutzenkonzeption für die Risikonutzentheorie
und die Wohlfahrtsökonomik nicht. Der abnehmende Grenznutzen von Einkommen kann
jedoch beide Verhaltensweisen erklären. Er kann auch intrapersonelle Nutzenvergleiche,
etwa zur Verteilung von Einkommen über Perioden, erklären. Die Annahme einer kardinalen Nutzenfunktion und
der Maximierung des daraus erwarteten Nutzens bei Risiko ist daher ein überaus
plausibles Konzept: "...the analysis
of impersonal value judgements concerning social welfare seems to suggest a
close affinity between the cardinal utility concept of welfare economics and
the cardinal utility concept of the theory of choices involving risk." [59]
3.1.4 Ermittlung von Nutzenfunktionen über ungewissen Ereignissen
Die Erwartungsnutzentheorie
versucht Nutzenfunktionen mit Hilfe einer Beurteilung von ungewissen
Ereignissen und deren Eintrittswahrscheinlichkeiten zu ermitteln. Dazu wird ein
einstufiges Modell benutzt, d.h. die Alternativen können als einstufige
Lotterie definiert werden. Eine Alternativenmenge, die aus zwei riskanten
Alternativen a und b besteht, läßt sich als zwei Vektoren (a1,p1;...;an,pn)
und (b1,q1;...;bn,qn) darstellen,
wobei das Ereignis a1 mit der Wahrscheinlichkeit p1
eintritt. Die Präferenzen über die riskanten Alternativen müssen also vom
Nutzen der jeweiligen Alternativen und der jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeit
abhängen. Der Vorteil dieser Verfahren ist, daß man Lotterien tatsächlich
anbieten könnte und die
Präferenzen, die der Entscheider äußert, sind daher weniger theoretisch als
jene über Wertfunktionen.
Der Erwartungsnutzen oder Expected Utility EU einer Lotterie ist definiert als
![]()
![]()
Diese Nutzenfunktion ist eindeutig, bis auf positive lineare Transformation mit u´ = au+b mit a>0.
3.1.5 Methoden zur Bestimmung von Risikonutzenfunktionen
3.1.5.1 Die Basis-Referenz-Lotterie
Die Nutzenfunktion des Entscheiders wird durch die Beurteilung einzelner Alternativen ermittelt. In den meisten dieser Verfahren wird eine Lotterie über zwei Ereignisse mit ihrem Sicherheitsäquivalent (SÄ) verglichen. Das Sicherheitsäquivalent ist definiert als ein sicheres Ereignis, dem das Wirtschaftssubjekt den gleichen Nutzen zuordnet wie der dazugehörigen Lotterie und daher indifferent zwischen beiden ist (Abb. 2).
|
|
|
Abb. 2
Basis-Referenz-Lotterie Quelle: EISENFÜHR/WEBER S. 221 |
Die Basis-Referenz-Lotterie (BRL) ist eine einfache
Lotterie mit zwei Ereignissen und deren jeweiligen Eintrittswahrscheinlichkeiten.
Durch die Vergleiche von Lotterien untereinander oder von Lotterien und
Sicherheitsäquivalenten lassen sich mit Hilfe der Erwartungsnutzentheorie die
Nutzenfunktionen bestimmen. Unterschiedliche Methoden erreichen dies durch
Variation der unsicheren Ereignisse, der Wahrscheinlichkeiten oder der
Sicherheitsäquivalente, bis zwischen den zu beurteilenden Alternativen Indifferenz
besteht.
3.1.5.2 Die Mittelwert-Kettungs-Methode
Bei
dieser Methode muß das Individuum ein Sicherheitsäquivalent angeben, bei dem es
indifferent gegenüber der BRL ist. Das Sicherheitsäquivalent einer Lotterie,
bei welcher der beste mögliche Wert (Xmax) und der schlechteste Wert
(Xmin) mit jeweils 50% Wahrscheinlichkeit eintreten, wird mit X0,5
bezeichnet. Es stellt die wertmäßige Mitte des Intervalls dar. Daraufhin werden
durch Lotterien zwischen Xmin und X0,5, sowie Xmax
und X0,5 auf die gleiche Weise X0,25 und X0,75
(Abb. 3) bestimmt. So lassen sich jeweils Alternativen finden, die genau den
mittleren Nutzen zwischen zwei anderen Alternativen liefern, und es lassen sich
beliebig viele Punkte der Risikonutzenfunktion bestimmen.[60]
|
|
|
Abb.
3 Die Mittelwert-Kettungs-Methode Quelle; EISENFÜHR/WEBER S.
222 |
3.1.5.3 Die Fraktilmethode
Bei dieser Methode werden die Konsequenzen der Lotterie unverändert gelassen. Dafür werden die Wahrscheinlichkeiten verändert. Durch die entsprechende Mischung von Wahrscheinlichkeiten für Xmax und Xmin läßt sich die Basis-Referenz-Lotterie so verändern, daß Indifferenz zu dem jeweiligen Sicherheitsäquivalent besteht.
|
|
|
Abb. 4 Die Fraktilmethode Quelle:
EISENFÜHR/WEBER S. 225 |
3.1.5.4 Die Methode variabler Wahrscheinlichkeiten
Bei
dieser Methode sind das Sicherheitsäquivalent und die Konsequenzen der BRL
vorgegeben. Der Entscheider variiert die Wahrscheinlichkeiten so, daß zwischen Lotterie
und sicherem Ereignis Indifferenz besteht. Diese Abfragemethode ist dann zu
empfehlen, wenn die Anzahl der möglichen Konsequenzen gering ist, so daß kein Sicherheitsäquivalent
gefunden werden kann.
|
|
Abb. 5 Methode variabler Wahrscheinlichkeiten Quelle: EISENFÜHR/WEBER S. 226 |
3.1.5.5 Die Lotterievergleichsmethode
Es
werden bei dieser Methode nur Lotterien miteinander verglichen. Zunächst wird eine
Bestimmungswahrscheinlichkeit p* (z.B. 50%) gewählt. Der Entscheider bestimmt
daraufhin die Wahrscheinlichkeiten p(0,25), p(0,5) und p(0,75) so daß er
Indifferenz zwischen den jeweiligen Lotterien herstellt (Abb. 6). Mithilfe der
nutzentheoretischen Annahmen läßt sich die Risikonutzenfunktion konstruieren,
da gelten muß:
pa u(xmax)+(1-pa) u(xmin) = p* u(xmin+a(xmax-xmin)) + (1-p*)u(xmin)
Auch diese Methode läßt sich anwenden, wenn die Zahl der Konsequenzen beschränkt ist. Der Vergleich von Lotterien und die Festlegung von Wahrscheinlichkeiten stellt jedoch hohe Anforderungen an den Entscheider.
|
|
|
Abb. 6 Die
Lotterievergleichsmethode Quelle: EISENFÜHR/WEBER S.
228 |
3.2 John Rawls
3.2.1 Grundlagen der Theorie des Gesellschaftsvertrages
Obwohl John Rawls kein Ökonom ist, hat seine Theorie der Gerechtigkeit die wirtschaftswissenschaftliche Diskussion der letzten Jahre so stark beeinflußt wie kaum ein anderes Werk. Dies mag zum einen an der lebendigen Diskussion über Theorien des Gesellschaftsvertrages zwischen Rawls und Minimalstaatstheoretikern sowie den Anhängern der Public-Choice Theorie liegen, zum anderen auch daran, daß Rawls ökonomische Methoden verwendet, die er gleichsam durch einen Kunstgriff in die Sphäre der reinen Ethik überträgt.[61] Die ökonomischen und ökonomienahen Theorien über den Gesellschaftsvertrag haben vieles zur Wiederherstellung der Ökonomie als allgemeine Sozialwissenschaft beigetragen. Die Anwendung ökonomischer Methoden auf weitere Erkenntnisgebiete, oft als methodologischer Imperialismus bezeichnet, ist inzwischen ein wohleingeführter Wissenschaftsbereich, für den mehrere Nobelpreise vergeben wurden. Dabei werden die mathematischen Methoden der Neoklassik benutzt, ihre Annahmen jedoch überprüft und gegebenenfalls variiert.
3.2.3 Gerechtigkeit als Fairness
Über die normativen Grundsätze, welche eine gerechte Gesellschaft konstituieren, sollen die Individuen einen Gesellschaftsvertrag schließen, dem sie alle zustimmen können. Im Gegensatz zu anderen Gesellschaftsvertragstheorien wird der Vertrag in einem hypothetischen Urzustand – hinter einem Schleier der Unwissenheit – geschlossen. Die Individuen sollen in dieser Entscheidungssituation weder ihre zukünftige soziale Stellung noch ihre natürlichen Veranlagungen und Fähigkeiten kennen. Auch ihre psychologischen Neigungen, wie z.B. Neid, sind den Individuen nicht bekannt. Rawls bezeichnet diese Ausgangssituation als fair, weil sich alle Individuen in der gleichen Lage befinden. Rawls hat nun eine bestimmte Theorie darüber, welche Gesellschaftsordnung vernunftbegabte, freie Menschen wählen würden, wenn sie in einer derartigen Entscheidungssituation befänden. Dieser theoretische Urzustand hebt die Möglichkeit zur Vertretung individueller, egoistischer Interessen oder von Gruppeninteressen auf. Es ist daher möglich, tatsächliche Werturteile und Meinungen von der Vertretung von Interessen zu trennen. Ob ein Individuum eine hohe Erbschaftssteuer befürwortet oder eine staatliche Gleichverteilung aller Erbschaften, dürfte normalerweise nicht unerheblich von der Tatsache beeinflußt werden, ob das Individuum selbst eine Erbschaft zu erwarten hat oder ob nicht. Der Schleier der Unwissenheit trennt nun die Wertentscheidung völlig von der persönlichen Situation.[62] Nach der Definition des Urzustandes müssen die verschiedenen Grundsätze, die in ihm gewählt werden können konkretisiert werden und es muß dargelegt werden, welcher von ihnen tatsächlich gewählt würde.
3.2.4 Die beiden Grundsätze der Gerechtigkeit
Die Grundsätze sozialer Gerechtigkeit bilden die Grundstruktur der Gesellschaft, das heißt eines Institutionensystems, welches das Zusammenleben regelt. Dabei muß zwischen den konstitutiven Grundsätzen, also jenen Regeln, die Rechte und Pflichten determinieren, und Strategien und Maximen unterschieden werden, welche die möglichen Handlungen innerhalb der konstitutiven Regeln umreißen.
Der erste Grundsatz der Gerechtigkeit lautet: „Jedermann soll gleiches Recht auf das umfangreichste System gleicher Grundfreiheiten haben, das mit dem gleichen System für alle anderen verträglich ist.“[63] Zu den Grundfreiheiten, also dem was man auch Grund- und Menschenrechte nennen würde, zählt Rawls die politische Freiheit (aktives und passives Wahlrecht), die Rede- und Versammlungsfreiheit, die Unverletzlichkeit der Person, Garantie des persönlichen Eigentums und die Grundsätze der Rechtsstaatlichkeit (z.B. Schutz vor willkürlicher Verhaftung etc.). Der zweite Grundsatz der Gerechtigkeit lautet: „ Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten sind so zu gestalten, daß (a) vernünftigerweise zu erwarten ist, daß sie zu jedermanns Vorteil dienen, und (b) sie mit Positionen und Ämtern verbunden sind, die jedem offenstehen.[64] Dies ist eine extreme Formulierung der Chancengleichheit, die über die Formulierung Mills hinausgeht. Rawls genügt nicht der gleiche formale Zugang zu gesellschaftlichen Positionen, auch die statistische Wahrscheinlichkeit zu ihrer Erreichung soll gleich verteilt sein, ein Prinzip, daß er „fair equality of opportunity“ nennt. Beispielsweise könnte die Finanzierung eines Studiums durch ein ererbtes Vermögen zusätzlichen Nutzen schaffen, da der soziale Nutzen genauso hoch, der Nutzen des Erblassers zusätzlich sein könnte. Unterschiedliche Bildungschancen durch Abstammung würden Rawls Prinzipien jedoch auch dann widersprechen, wenn sie zu einer Erhöhung des sozialen Nutzens führten. Am Beispiel einer Gesellschaft, die aus zwei sozialen Schichten, der Oberschicht (O) und der Unterschicht (U) besteht, läßt sich dieses Prinzip verdeutlichen. Die Menschen werden in eine der Schichten geboren und gehören ihr als Erwachsener je nach Stellung weiterhin an oder nicht. Daraus ergeben sich vier mögliche Kombinationen OO (geboren in der Oberschicht, ihr auch als Erwachsener zugehörig) OU, UO und UU. Wenn Leistungswille und Begabungen gleich verteilt sind, aber in der Oberschicht genügend Leute geboren und auf Kosten ihrer Eltern ausgebildet würden, so könnten fast alle Führungspositionen mit ihnen besetzt werden. Die so beschrieben Sozialordnung ist in Abb. 7 dargestellt.
|
Gesellschaftsordnung 1 |
Lebensindexposition |
Bevölkerungsanteil |
|
OO |
180 |
9% |
|
UO |
170 |
1% |
|
OU |
110 |
1% |
|
UU |
100 |
89% |
|
Durchschnitt |
108 |
— |
Abb. 7
Gesellschaftsordnung 1
Quelle: POGGE, S. 100
Eine Ausbildung von Kindern auf Staatskosten würde sich nicht lohnen und keine Verbesserung der jeweiligen Lebensumstände mit sich bringen, aber für Erwachsene die gleiche Wahrscheinlichkeit der Zugehörigkeit zur Oberschicht zu gehören, unabhängig von ihrer Geburt. Eine solche Gesellschaftsordnung ist in Abb. 8 dargestellt. Das Chancengleichheitskriterium bewertet die Gesellschaftsordnung 2 als besser, obwohl das durchschnittlich erreichbare Nutzenniveau geringer ist als in Gesellschaftsordnung 1 und das Nutzenniveau jeder einzelnen Gruppe unter dem in Gesellschaftsordnung 1 erreichbarem liegt.[65]
|
Gesellschaftsordnung 2 |
Lebensindexposition |
Bevölkerungsanteil |
|
OO |
162 |
1% |
|
UO |
153 |
9% |
|
OU |
99 |
9% |
|
UU |
90 |
81% |
|
Durchschnitt |
97 |
— |
Abb. 8 Gesellschaftsordnung
2
Quelle: POGGE, S. 100
Ein weiter Aspekt von Rawls Grundsätzen der Gerechtigkeit ist die lexikalische Ordnung zwischen den einzelnen Gerechtigkeitsgrundsätzen. Zwischen zwei Zuständen der Gesellschaft wird zunächst nach der Verwirklichung des ersten Grundsatzes verglichen. Nur Gesellschaftsordnungen, die den ersten Grundsatz gleich gut erfüllen, werden nach dem zweiten Grundsatz verglichen (Lexikalisch heißt diese Ordnung, weil in einem Lexikon die Begriffe zunächst nach dem Anfangsbuchstaben, dann nach dem zweiten Buchstaben etc. geordnet werden.). Diese Art der Ordnung führt dazu, daß keine Verbesserung im Sinne des zweiten Grundsatzes, und sei sie noch so groß, eine Verschlechterung im Sinne des ersten Grundsatzes kompensieren kann, und sei diese auch noch so geringfügig.[66]
3.2.5 Das Unterschiedsprinzip
Zunächst sollen die gesellschaftlichen Zustände (soweit sie den beiden vorhergehenden Kriterien genügen) nach dem Pareto-Kriterium geordnet werden. Das heißt, so lange es möglich ist, Individuen besserzustellen, ohne andere schlechterzustellen, soll dies durchgeführt werden.
Danach soll die Versorgung der Individuen mit Grundgütern sichergestellt werden, die Rawls als solche Güter definiert: „von denen man annehmen darf, daß ein vernünftiger Mensch sie haben möchte, was er immer er sonst noch haben möchte.“[67] Dazu zählt er Rechte und Freiheiten sowie Chancen und auch Vermögen und Einkommen und außerdem Werte wie Selbstwertgefühl. Mit den Rechten und Freiheiten beschäftigt sich der erste, mit den Chancen der zweite Grundsatz. Das Selbstwertgefühl wird als nicht direkt faßbar betrachtet und vorerst ausgeklammert. Mit Einkommen und Vermögen befaßt sich das Differenzprinzip, das Rawls wie folgt definiert: „Soziale und wirtschaftliche Ungleichheiten müssen so beschaffen sein, daß sie den am wenigsten Begünstigten den größtmöglichen Vorteil bringen und mit Ämtern und Positionen verbunden sind, die allen gemäß fairer Chancengleichheit offenstehen“.[68] Die Beurteilung gesellschaftlicher Zustände richtet sich also zunächst allein am Wohl des Individuums aus, das am schlechtesten dasteht. Betrachtet man einen Fall mit zwei Individuen, so läßt sich das Differenzprinzip mit Hilfe rechtwinkliger Indifferenzkurven darstellen (Abb. 9, Fall 2). Der Nutzen der Individuen A (Ua) und B (Ub) ist auf den jeweiligen Achsen abgetragen, die Winkelhalbierende stellt daher den Ort aller Kombinationen mit gleichem Nutzen dar. Angenommen, es sei nur eine Bewegung weg von der Gleichverteilung möglich und die Punkte auf der Kurve (gestrichelt dargestellt) wären mögliche Verteilungen, so wäre für Rawls der Punkt (B) optimal. Bis zu diesem Punkt steigt der Nutzen beider Individuen. Eine Bewegung bis zur Verteilungssituation wie in Punkt (A) würde den Nutzen des Schlechtergestellten (Ua) absenken, wäre also nach Rawls abzulehnen. Die utilitaristische Position, also die Bewertung nach höchster Nutzensumme, ist in Fall 1 dargestellt. Die Indifferenzkurven folgen aus der additiven Nutzenfunktion und sind parallele Geraden senkrecht zur Winkelhalbierenden. Die Verteilung in Punkt A erreicht hier eine höhere Indifferenzkurve, weil der Nutzengewinn von B höher ist als der Nutzenverlust von A.
|
|
|||
Abb. 9 Indifferenzkurven der
Wohlfahrtsfunktionen, Quelle, Rawls: S.
138 |
3.2.6 Die entscheidungstheoretische Begründung für das rawlsianische Differenzprinzip
Rawls unterstellt den Individuen eine vollständige Risikoaversion bei der Entscheidung im Urzustand. Die Verteilung von möglichen Einkommen und Vermögen soll nach der Maximin-Regel beurteilt werden. Er unterstellt dabei, daß es den Individuen fast gleichgültig sei, ob sie über das Minimum, welches diese Regel garantiert, noch mehr erreichen können. Für die Möglichkeiten einer Verbesserung über das Minimum hinaus nimmt Rawls zumindest keine Bereitschaft an, die sicher erreichbare Position zu riskieren. Aus der Möglichkeit, daß ein Individuum zu den am schlechtesten gestellten gehören könnte, wird abgeleitet, daß die Individuen so entscheiden würden, als gehörten sie mit Sicherheit zu ebenjenen. Die Unterstellung solch einer totalen Risikoaversion ist überaus fragwürdig und mit der vorausgesetzten Unwissenheit nur schwer vereinbar. Auch ist kaum anzunehmen, daß diese Annahme zu Fairnis führt, denn das Individuum wird so zum Interessenvertreter einer bestimmten Schicht, während das Prinzip doch eigentlich Fairnis im Sinne von Unparteilichkeit sicherstellen soll.[69]
Rawls führt noch weitere Begründungen für die Verwendung des Maximin-Prinzips an. Zunächst einmal spricht eine gewisse Einfachheit für dieses Prinzip, weil nicht der Nutzen aller Menschen gemessen und saldiert werden muß, sondern nur der Nutzen der am schlechtesten gestellten Individuen. Da hier jedoch Meßbarkeit und Konsens über Nutzenvorstellungen herrschen muß, scheint diese Vereinfachung im Vergleich zu einer utilitaristischen Funktion eher geringfügig. Ein weiteres Argument, das Rawls benutzt, ist die Manipulationsgefahr bezüglich Argumentationen, die sich auf die Nutzensumme beziehen. Individuen könnten aus Eigeninteresse immer eine Begründung finden, warum die Durchsetzung ihrer Interessen dem Gesamtnutzen zugute käme. Hier wechselt Rawls jedoch die Argumentationsebene. Egoistische Individuen, die ihre Interessen durchsetzen wollen und diese in der Realität umsetzen, haben wohl noch weniger Veranlassung, sich nach Rawls Prinzipien auszurichten.
3.3 Die
Position von Harsanyi
Obwohl John C. Harsanyi seine
Thesen teilweise bereits früher veröffentlicht hat als John Rawls, ist seine
Konzeption des Gesellschaftsvertrags vor allem als Gegenposition zu dessen
Theorie bekannt geworden. Einige Überlegungen sind auch als kritische
Auseinandersetzung mit Rawls formuliert und vor allem der Diskussionsprozess um
die beiden Positionen ist in den einschlägigen Fachzeitschriften zu verfolgen.[70]
3.3.1 Der
unparteiische Beobachter
Bei der Darstellung der Entscheidungssituation, in der über den Gesellschaftsvertrag
bestimmt wird, greift Harsanyi auf das Konzept des impartially sympathetic observer, also eines fairen und unparteiischen Schiedsrichters zurück,
der für alle betroffenen Individuen das gleiche Maß an Einfühlungsvermögen
besitzt. Die gesellschaftliche Nutzenfunktion soll auf den Nutzenfunktionen der
Individuen beruhen und einen fairen Kompromiß zwischen diesen darstellen.
Dieser läßt sich erreichen, wenn die Individuen ihre persönlichen Präferenzen außer acht lassen und nur ihre ethischen Präferenzen einbringen.
Letztere sind die Präferenzen eines Individuums, das die Stellung, welches es
in einer bestimmten Sozialordnung einnehmen würde, nicht kennt, wenn es darüber
zu entscheiden hat. Ob es eine marktwirtschaftliche oder sozialistische Wirtschaftsordnung
befürwortet, soll nicht davon abhängen, daß es in der Marktwirtschaft z.B. Millionär,
in der sozialistischen Wirtschaft nur Staatsangestellter wäre. Dieser Urzustand
beschreibt mit anderen Worten die gleiche Entscheidungssituation, die auch John
Rawls mit dem Schleier der Unwissenheit
bezeichnet.[71]
3.3.2
Erwartungsnutzenmaximierung im Gleichwahrscheinlichkeitsmodell für ethische
Werturteile
Im Urzustand richtet sich das Verhalten der Individuen nach den entscheidungstheoretischen
Regeln für rationales Verhalten unter
Unsicherheit. Die Individuen haben keine Information darüber, mit welcher
objektiven Wahrscheinlichkeit sie einer bestimmten sozialen Position zugeordnet
würden, aber gerade daraus läßt sich eine subjektive
Wahrscheinlichkeit annehmen. Es ist dann vernünftig, daß der Entscheider
annimmt, daß er jedes zur Auswahl stehende Nutzenniveau mit gleicher
Wahrscheinlichkeit erreichen wird. Unter diesem Gleichwahrscheinlichkeitspostulat werden die Individuen versuchen,
ihren zu erwartenden Nutzen zu maximieren. In einer Gesellschaft aus n Mitgliedern
werden die individuellen Nutzenniveaus U1, U2,.....,Un
verwirklicht. Der Entscheider
kann nun unter Beachtung des Gleichwahrscheinlichkeitspostulates davon ausgehen,
daß er jedes der möglichen Nutzenniveaus mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/n
erreicht. Die Annahme gleicher Wahrscheinlichkeiten ist auch Ausdruck eines
Werturteils, das besagt, daß den Interessen aller Gesellschaftsmitglieder a
priori gleiches Gewicht beizumessen ist. Zur Begründung führt Harsanyi an, daß
alle Menschen nach gleichen fundamentalen psychologischen Gesetzen
funktionieren. Die grundsätzliche Fähigkeit, Nutzen zu empfinden, ist bei allen
Menschen gegeben. Eine Ablehnung dieser Voraussetzung führt daher zu einer
solipsistischen Position, nach der man sich selbst letztlich als einziges
denkendes und fühlendes Wesen definieren müßte.[72]
Dieses Werturteil dürfte relativ unstrittig sein; zumindest kommt auch
die Wohlfahrtstheorie auf Grundlage ordinaler Nutzenvorstellungen nicht ohne
die Annahme prinzipieller Gleichgewichtung des Einflusses der Individuen auf
den gesellschaftlichen Nutzen aus.[73]
Unter den Annahmen der Gleichwahrscheinlichkeit und der kardinalen Meßbarkeit
von Nutzen wird der Entscheider im Urzustand jene Gesellschaftsordnung
vorziehen, die den höchsten Erwartungsnutzen
verspricht. Die Funktion zur Bewertung des gesellschaftlichen Nutzens ist also
die Erwartungsnutzenfunktion mit der Wahrscheinlichkeit 1/n für jeden Nutzen (U1,.....,Un),
also:
![]()
Die Überlegungen Harsanyis führen also im Ergebnis
zu einer ungewichteten, additiven Nutzenfunktion, also einem Durchnittsnutzenkriterium. Es ist daher
möglich, eine soziale Nutzenfunktion des utilitaristischen Typs im Sinne Amartya Sens zu konstruieren, die zu
linearen und homothetischen, sozialen Indifferenzkurven führt (Abb. 9).
3.3.3 Die
axiomatische Formulierung von Harsanyis Prinzipien
Harsanyi greift auf die Rationalitätspostulate
von Marschak zurück. Seine Postulate
lauten:
Postulat (a): Die sozialen Präferenzen erfüllen
alle vier Rationalitätspostulate Marschaks.
Postulat (b): Die individuellen Präferenzen
erfüllen ebenfalls die Rationalitätspostulate.
Postulat (c): Wenn zwischen zwei Zuständen P und
Q von Standpunkt jedes Individuums Indifferenz herrscht, so sollen sie auch von
der gesellschaftlichen Bewertung indifferent sein.
Falls der Nullpunkt der individuellen Nutzenfunktionen
definiert werden kann, so existiert eine soziale Wohlfahrtsfunktion, die eine
gewichtete Summe der individuellen Nutzen ist.
Theorem 1: Es gibt eine soziale Wohlfahrtsfunktion,
für welche gilt, daß ihr Wert die sozialen Präferenzen ausdrückt. Diese
Funktion ist eindeutig bis auf lineare Transformationen.
Theorem 2: Für jedes Individuum existiert eine
Nutzenfunktion, welche die jeweiligen Präferenzen ausdrückt. Auch diese ist
eindeutig bis auf lineare Transformationen.
Diese Theoreme folgen aus den Postulaten Marschaks.
Nun soll Us eine soziale, dem Theorem 1 genügende Wohlfahrtsfunktion
sein, und Ui die individuelle Nutzenfunktion des Individuum (i)
sein, die Theorem 2 genügt. Wenn der Nutzen aller Individuen 0 ist, soll auch
die soziale Wohlfahrtsfunktion den Wert 0 annehmen:
U1=U2=...=Un=0
folgt Us=0
Theorem 3: Us ist eine einwertige (single-valued) Funktion der
individuellen Nutzen. Dies folgt im Hinblick auf die Theoreme 1 und 2 aus
Postulat (c).
Theorem 4: Us ist eine homogene
Funktion erster Ordnung der individuellen Nutzen. Zur Prüfung kann gezeigt
werden, daß, wenn die individuellen Nutzenfunktionen die Werte U1=u1;
U2=u2;.....;Un=un annehmen und
daraus folgt, daß die soziale Wohlfahrtsfunktion den Wert Us=us
annimmt, aus individuellen Nutzen U1=ku1; U2=ku2;.....;
Un=kun ein sozialer Nutzen von Us=kus resultiert.
Für 0£k£1 kann gezeigt werden, daß, wenn der Zustand 0
bedeutet, daß die individuellen Nutzen alle den Wert Null haben, auch die
soziale Wohlfahrtsfunktion den Wert Null hat, und der Zustand P bedeutet, daß U1=u1;U2=u2;.....Un=un
und Us=us, so gibt es einen Zustand Q, der bedeutet, daß
Zustand 0 mit der Wahrscheinlichkeit (1-p) und Zustand P mit der
Wahrscheinlichkeit p eintritt. Die individuellen Nutzen in Q sind dann Ui=pui
und der soziale Nutzen Us=pus.
Für den Fall, daß k<0 gilt, kann man einen
Zustand R definieren, so daß der Zustand 0 äquivalent zum gemischten Zustand
aus R mit Wahrscheinlichkeit p und P mit einer Wahrscheinlichkeit 1-p ist. R repräsentiert dann Ui=(1-1/p)ui
für die Individuen und Us=(1-1/p)us für die Gesellschaft.
Wenn man k=1-1/p schreibt, so kann ein Vergleich der Variablen, die zu R und P
gehören, jedes gewünschte Ergebnis für den Fall k<1 erzeugen, weil sich
durch die Wahl von p ein beliebiges negatives k erzeugt werden kann.
Schließlich kann auch für den Fall k>1 ein
Zustand S definiert werden, so daß ein gemischter Zustand aus S und 0 mit den
Wahrscheinlichkeiten p und (1-p) äquivalent mit P ist. In S gilt dann Ui=(1/p)ui
und Us=(1/p)us. Wenn man k=1/p schreibt, kann k jeden
Wert größer als eins annehmen.
Theorem
4: Us ist eine gewichtete Summe der individuellen Nutzen in
der Form:
![]()
Dabei ist ai der Wert , den Us
annimmt, wenn Ui=1ist und alle anderen individuellen Nutzen gleich
Null sind. Wenn Si ein
Zustand ist, in dem Ui der Nutzen des Individuums i ist, der Nutzen
der anderen 0, so ist in Si die soziale Wohlfahrt Us=aiUi.
Nun sei T ein Zustand in dem S1, S2, ...., Sn
mit einer Wahrscheinlichkeit von 1/n eintreten. T repräsentiert dann die
individuellen Nutzen (1/n) Ui und daher die soziale Wohlfahrt:
![]()
Damit ist gezeigt worden, daß die soziale Wohlfahrtsfunktion
eine gewichtete Summe der individuellen Nutzen sein muß. Folgt man zusätzlich
dem Werturteil der Gleichgewichtung, so gelangt man zur utilitaristischen Wohlfahrtsfunktion.[74]
3.3.4
Harsanyis Kritik an John Rawls
Mit dem Erwartungsnutzenkriterium hat Harsanyi
eine entscheidungstheoretisch weitaus besser fundierte Grundlage für die Wahl einer
Gesellschaftsordnung im Urzustand. Das Maximin-Kriterium wird jedoch weiterhin
verteidigt, z. B. mit der Begründung,
im Urzustand könnten keine Wahrscheinlichkeiten verwendet werden und es gäbe keinen
Grund, ein höheres Nutzenniveau als das Minimum anzustreben, wenn selbiges dazu
riskiert werden müsse.
Der schlagkräftigste Kritikpunkt an Rawls Gerechtigkeitstheorie liegt
in den Paradoxien, die bei Verwendung des Maximin-Kriteriums auftreten. Anhand
von einigen Beispielen zeigt Harsanyi, daß kaum jemand bereit wäre, dieses
Kriterium für Entscheidungen zu nutzen, die sein tägliches Leben betreffen.
Falls man sich ausschließlich daran orientiert, daß schlechteste Ergebnis zu
maximieren, dürfte man keine Liebesbeziehung beginnen, da man im Falle einer
Trennung unglücklicher wäre als wenn man die Beziehung gar nicht begonnen
hätte. Harsanyi stellt die Entscheidung über eine Bewerbung für eine Arbeitsstelle
in einer anderen Stadt, die nur mit dem Flugzeug erreichbar ist, dar (Abb. 10).
Wenn die Möglichkeit existiert, daß das Flugzeug abstürzt und damit die
schlechteste Möglichkeit eintritt, muß danach auf die Bewerbung verzichtet
werden, weil das schlechteste Ergebnis ohne Bewerbung besser ist. Eine solche
Entscheidung ohne Betrachtung der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit führt daher
kaum zu akzeptablen Ergebnissen.
|
|
Das Flugzeug stürzt ab |
Das Flugzeug kommt an |
|
keine Bewerbung |
Schlechter Job, aber man bleibt am Leben |
Schlechter Job, aber man bleibt am Leben |
|
Bewerbung |
Man stirbt |
Toller Job, und man bleibt am Leben |
|
Abb. 10 Auswirkungen des Maximin-Kriteriums Quelle: HARSANYI, Maximin
Principle, S. 595. |
||
Rawls verteidigt seine Theorie mit der Behauptung, daß solche Probleme nur in Ausnahmesituationen auftreten: „ Objections by the way of counterexamples are to be made with care, since they may tell us only what we know already, namly that our theory is wrong somewhere. The important thing is to find out how often and how far it is wrong.“[75] Harsanyi antwortet auf diese Immunisierungsstrategie, daß Rawls Theorie fundamentale Fehler aufweise, und nur dann zu vernünftigen Ergebnissen führe, wenn die Verwendung des Maximin-Kriteriums mit der Erwartungsnutzentheorie vereinbar sei.
Ein ähnliches Argument spricht gegen die Verwendung der lexikalischen
Ordnung von Rawls Prinzipien. Auch utilitaristische Argumente sprechen dafür,
den Freiheitsrechten hohes Gewicht einzuräumen, da sie es den Individuen erst
ermöglichen, sich gemäß ihren Präferenzen zu verhalten. Die Garantie
rechtsstaatlicher Verfahren schafft Sicherheit für die Bürger. Furcht vor Willkürmaßnahmen,
Folter etc. dürfte einen ganz erheblichen Nutzenverlust herbeiführen. Aber auch
wenn diese Güter ein sehr hohes Gewicht in den Nutzenfunktionen haben, so gibt
es doch einen Trade-off mit anderen Gütern. Eine sehr geringfügige
Verschlechterung der Grundrechte würde für einen hohen Zuwachs an Wohlstand
hingenommen. In der Realität zeigen die politischen Debatten, daß elementare
Freiheitsrechte keineswegs einen unbedingten Vorrang genießen. Auch repressive
Regime finden oft weitreichende Unterstützung der Bevölkerung, was nicht allein
damit erklärt werden kann, daß die Befürworter sicher sind, daß sie nicht zu
den Opfern zählen werden.
Ein weiteres Beispiel zeigt die
Probleme auf, die bei Rawls Prinzipien auftreten. Ein Arzt hat zwei Patienten,
einen Todkranken und einen, den er heilen könnte. Er hat jedoch nur eine Dosis
des betreffenden Medikamentes zur Verfügung. Dem Todkranken würde das Medikament
kurzzeitige Erleichterung bringen, den anderen Patienten vollständig heilen.
Rawls hielte es in dieser Situation für moralisch richtig, zunächst nur den
Nutzen des Schlechtergestellten zu betrachten, also dem Todkranken das
Medikament zu verabreichen. In dieser Situation würden wohl die meisten
Menschen den utilitaristischen Standpunkt teilen und das Medikament dort
einsetzen, wo es den größten Nutzen bewirkt, also es dem heilbaren Patienten zu
verabreichen. So wie in diesem Fall nehmen Menschen im täglichen Leben durchaus
interpersonelle Nutzenvergleiche vor, so daß die utilitaristische Position,
wenn sie realitätsnah modelliert wird, auch mit den meisten Auffassungen der
„common-sense“ Moral übereinstimmt.[76]
3.3.5 Die Kritik von Diamond
Peter Diamond kritisiert das Durchschnittsnutzenkriterium mit dem Hinweis auf besondere Situationen, in denen es gewöhnlichen Vorstellungen von Fairness widersprechen kann. In seinem Beispiel besteht die Gesellschaft aus zwei Individuen A und B mit identischen Nutzenfunktionen. Sie sollen über zwei Alternativen α und β entscheiden, die jeweils zu zwei Umweltzuständen F1 und F2 führen können, die beide mit gleicher Wahrscheinlichkeit eintreten. Die Nutzen der Individuen unter den jeweiligen Alternativen und den jeweiligen Umweltzuständen sind in Abb. 11 dargestellt.
|
|
F1 tritt ein |
F2 tritt ein |
|
Alternative α |
UA=1,
UB=0 |
UA=1,
UB=0 |
|
Alternative β |
UA=1,
UB=0 |
UA=0,
UB=1 |
Abb. 11
Quelle: DIAMOND, S. 766
Obwohl beide Alternativen den gleichen Durchschnittsnutzen haben, hält Peter Diamond die Alternative β für vorziehenswert, weil bei ihrer Wahl beide Individuen den gleichen Nutzen bekommen können, während bei der Entscheidung für Alternative α von vornherein feststeht, daß Individuum B auf dem Nutzenniveau 0 bleibt.[77]
Bei der Entscheidung im Urzustand
dürften die Alternativen jedoch nicht unterschiedlich beurteilt werden, weil
der Entscheider ja mit gleicher Wahrscheinlichkeit annehmen muß, A oder B zu
sein. Die Präferenz vieler
Menschen für die Alternative β ist daraus erklärbar, daß sie in der
Betrachtung ex-ante realiter im Sinne Benthams Pleasures of Expectation andere Nutzeneffekte durch die Hoffnungseffekte
haben müßte. Da in dem Beispiel die Nutzen jedoch feststehen und ex-post
ohnehin nur ein Individuum den Nutzen von 1 bekommt, gibt es keinen haltbaren
Grund für Diamonds Kritik.
3.3.6 Vergleich zwischen utilitaristischen und
rawlsianischen
Sozialordnungen unter verschiedenen Informationsannahmen
In seinem Vergleich der beiden vertragstheoretischen Konzeptionen benutzt Partha Dasgupta das Beispiel einer Ökonomie, in der die Individuen unterschiedliche Leistungsfähigkeit besitzen, ihre Freizeit in das einheitliche Konsumgut Einkommen umzusetzen. Jedes Individuum hat eine meßbare Leistungsfähigkeit n. In der Arbeitszeit l beträgt seine Produktion daher l•n. Der Nutzen der Individuen beruht auf Einkommen und Freizeit, dabei wird zunächst eine identische Nutzenfunktion für alle angenommen.
Zunächst wird die Verteilung des
Nutzens in einer laissez-faire Ökonomie
betrachtet. Jedes Individuum arbeitet ausschließlich für sich allein und realisiert
das Nutzenniveau, das seine Fähigkeiten ihm ermöglichen. Dabei ist das
Nutzenniveau einfach eine steigende Funktion der Fähigkeiten
(Abb. 12, Kurve 1).
Unter der Annahme, daß dem Staat vollständige Informationen über die Fähigkeiten und Nutzenfunktionen der Individuen vorliegen, kann der Staat die Nutzensumme maximieren. Dabei zwingt er die Leistungsfähigen, mehr zu arbeiten, und kann das höhere Einkommen an die weniger Befähigten verteilen. Da erstere produktiver sind, ist es möglich, entweder das Gesammteinkommen der Gesellschaft oder die Summe an Freizeit zu erhöhen. Je befähigter ein Individuum ist, desto geringer ist unter dieser Sozialordnung sein Nutzenniveau (Abb. 12, Kurve 2). Die Nutzensumme ist zwar höher, eine solche Sozialordnung dürfte realiter jedoch kaum durchsetzbar sein, und die Informationsannahmen sind wenig realistisch.
|
|
|
Abb.
12 Vergleich von Verteilungsnormen Quelle: DASGUPTA, S. 208 |
Unter realistischeren Informationsannahmen weiß der Staat nichts über die Fähigkeiten und die Freizeit der Individuen; er kann nur das Einkommen erfassen. Nun versucht der Staat ein Steuer- und Transfersystem zu errichten, in welchem Anreize existieren, daß sich die Individuen aus Eigeninteresse so verhalten, daß die soziale Wohlfahrt maximiert wird. Die steuerliche Belastung und die Transfers dürfen nur so hoch sein, daß der Nutzen, den die Umverteilung schafft, größer ist als der Nutzenverlust durch die disincentives to work. Die Nutzenverteilung ist in Abb. 12, Kurve 3 dargestellt.
Falls der Staat die Leistungsfähigkeit der Individuen beurteilen
könnte, so könnte er eine anreizneutrale Leistungsfähigkeitssteuer erheben.
Diese wäre zwischen Einkommen und Freizeit neutral. Das Ergebnis der Nutzenverteilung
wäre unter einer solchen Steuer identisch mit einer Sozialordnung, die dem
rawlsianischen Maximin-Prinzip folgen würde. Diese Verteilung ist in Abb. 12,
Kurve 4 dargestellt.
Die Annahmen, die Fall drei zugrunde liegen, sind relativ realitätsnah, und daher ist es nicht verwunderlich, daß ähnliche Steuer- und Transfersysteme häufig auftreten.[78]
3.4 Hayek und der Utilitarismus
Das Werk Friedrich August von
Hayeks ist nicht zuletzt aus seiner Auseinandersetzung mit utilitaristischen
Positionen, vor allem jener John Stuart Mills entstanden. Er unterzieht die
seiner Ansicht nach konstruktivistische
Position einer grundlegenden Kritik. Die Regeln, nach denen eine Gesellschaft
funktioniert, sind letztlich nicht planbar, sonder durch einen evolutionären
Prozeß gewachsen. Sie entziehen sich zum größten Teil menschlicher Erkenntnis.
Kein Planer kann das unendlich vielfältige Wissen, das in der Gesellschaft
vorhanden ist, kennen; seine Eingriffe in die spontanen Prozesse sind daher
eine „Anmaßung von Wissen“. In einer spontanen Ordnung kann ein Mechanismus
gegenseitiger Anpassung stattfinden, der zur Entwicklung beiträgt. Bestes
Beispiel dafür ist der Marktmechanismus.[79]
Ob diese soziale Evolutiontheorie
wirklich mit utilitaristischen Auffassungen kollidiert, ist fragwürdig. Keiner
der Klassiker der Nützlichkeitslehre hat ein Utopia geplant, in dem alles nach
seinen theoretischen Annahmen geregelt wird. Die Reformvorschläge der
Utilitaristen waren tatsächlich immer sehr vorsichtig und damit mit der evolutionären
Anpassung vereinbar: “Der moderne
Wohlfahrtsstaat – für Hayek ein Greuel – ist ‘evolutionär’ durch stückweises
‘social engineering’ entstanden.“[80]
Auch Hayek lehnt nicht jede Art von Planung ab. Organisationen können jedoch
nicht allzu komplex sein, da sie sonst an ihre Grenzen stoßen. Falls der Staat
Wissen, das zur Errichtung eines Steuer- und Transfersystems gebraucht wird,
tasächlich erlangen kann, ist es ein Eingriff in die Marktprozesse, der mit
diesen grundsätzlich vereinbar ist.
4. ZUSAMMENFASSUNG
Im ersten Teil der Arbeit wurde die Entwicklung der Theoriebildung bis zum klassischen Utilitarismus nachgezeichnet. In der Klassik bestand eine Theorie, die durch eine enge Verbindung ökonomischer und ethischer Betrachtung gekennzeichnet war und zudem ein in sich schlüssiges System bildete.
Durch die Trennung von Werturteilen und positiver Wissenschaft sowie aus der Position Paretos entstanden Theorien, in welche weitaus weniger Wertbezüge eingehen. Der Anwendungsbereich rein positivistischer Theorien ist im Bereich der Wohlfahrtstheorie sehr beschränkt. Der Versuch, auf der Grundlage ordinaler Nutzenmeßung Wohlfahrtskriterien zu entwickeln, hat letztendlich nicht zum Erfolg geführt. Ohne kardinale Nutzenmeßung und interpersonelle Vergleiche gilt das Arrowsche Unmöglichkeitstheorem.
Im Rahmen der modernen ökonomischen Vertragstheorien wird wieder eine starke Verbindung zwischen Ethik und Ökonomie hergestellt, jedoch wird dabei deutlich zwischen den normativen und den positiven Aspekten einer Theorie unterschieden.
Besondere Bedeutung kommt der
entscheidungstheoretischen Fundierung zu. Die Risikonutzentheorie liefert ein
Modell für individuelle
Entscheidungen in riskanten Situationen. Das kardinale Nutzenkonzept, das
dieser Theorie zugrunde liegt, läßt sich auf die Wohlfahrtstheorie übertragen.
Besonders bedeutsam sind die Rechtfertigungen, welche die normative Aspekte der Theorien in der metaethischen Analyse finden. Die Werturteile sind nicht Gegenstand der Analyse, sondern die Frage, auf welcher Basis sich die moralischen Präferenzen verschiedener Individuen aggregieren lassen.
Obwohl Rawls Gerechtigkeitstheorie große Aufmerksamkeit erregte und
auch in der Ökonomie rezipiert wurde, führt sie in der Wohlfahrtstheorie zu
überaus fragwürdigen Ergebnissen.
Der Ansatz Harsanyis, Erwartungsnutzenmaximierung im gesellschaftlichen Urzustand, liefert die überzeugenste moderne Wohlfahrtstheorie. Unter einigen Annahmen, die kaum werturteilsbehafteter sind als die Voraussetzungen der ordinalen Wohlfahrtstheorien, entscheiden sich die Individuen für gesellschaftliche Nutzenmaximierung utilitaristischer Spielart.
Obwohl ein akzeptables Wohlfahrtskriterium zur Verfügung
steht, ist bislang wenig an seiner Anwendung gearbeitet worden. Allein die
Arbeit von Dasgupta untersucht die
Auswirkung unterschiedlicher Informationsannahmen auf die soziale Wohlfahrt
unter Verwendung verschiedener Kriterien. Um mit der utilitaristischen
Wohlfahrtsfunktion jedoch tatsächlich arbeiten zu können, müssen einige Fragen
wissenschaftlich geklärt werden. Insbesondere für die zusammenhängende
Betrachtung des Steuer- und Transfersystems ist ein solches Kriterium geeignet,
denn hier sind redistributive Eingriffe des Staates anzusiedeln. Daß
Sozialtransfers in Geld erfolgen sollten, ist normalerweise anzunehmen.
Gebundene Transfers bewirken in der Regel eine Excess-Burden. Die Präferenzen der Haushalte über Einkommen und
Freizeit können prinzipiell erhoben werden. Befragungstechniken, aber auch
Experimente könnten Einsicht geben, wie stark Einkommensunterschiede auf
unterschiedliche Willensentscheidungen und wie stark sie auf unterschiedliche
Fähigkeiten zurückgehen. Eine Umverteilung von Einkommen zwischen Geringverdienern
und Personen mit hohem
Einkommen kann Nutzen erhöhen, eine solche zwischen Leistungswilligen und
"Freizeitorientierten" verringert dagegen Nutzen. Wenn es möglich
ist, die beiden einkommensbestimmenden Faktoren Fähigkeiten und Willensentscheidungen
zu isolieren, lassen sich die Wirkungen des Tranfersystems abschätzen. Die
optimale Umverteilung ist dann erreicht, wenn der Grenznutzen aus Umverteilung gleich
dem Grenznutzenverlust aus den disincentives
to work aus dem Transfersystem ist.
Mit einem solchen Transferoptimum ist natürlich nur eine Ideallösung gefunden. Die Umsetzung würde einen "wohlwollenden Diktator" erfordern. Die Wirkung einer ethischen Theorie im politischen Prozeß sollte man jedoch nicht unterschätzen. Sofern auch nur ein Teil der Akteure ethische Präferenzen hat, können diese doch langfristig als "Zünglein an der Waage" den Ausschlag zwischen divergierenden Interessen im politökonomischen Prozeß geben.